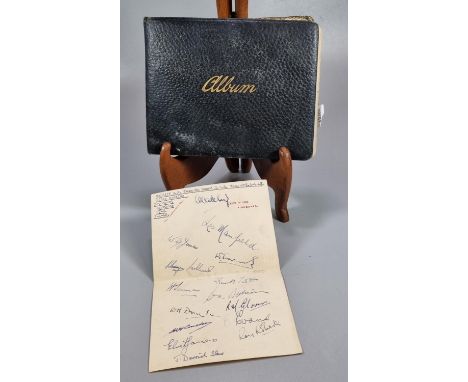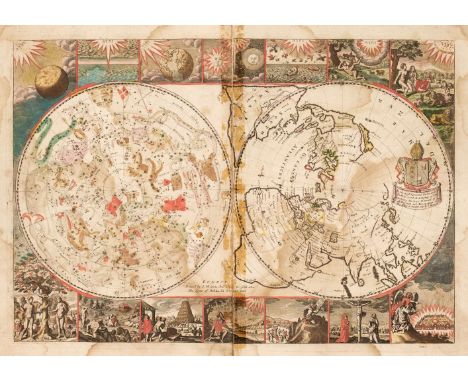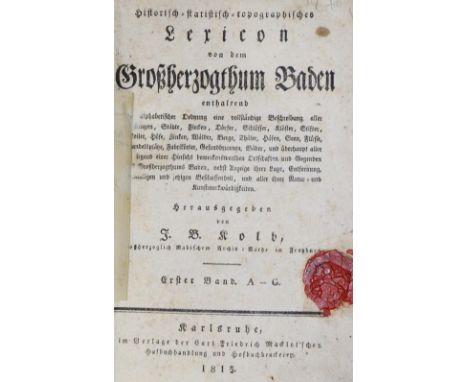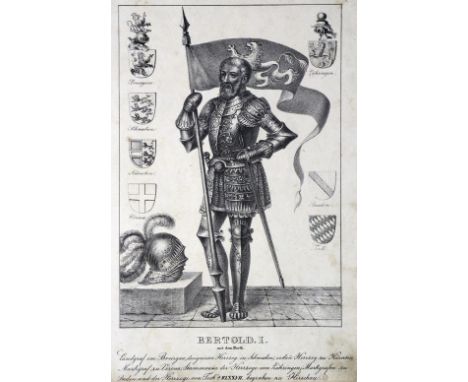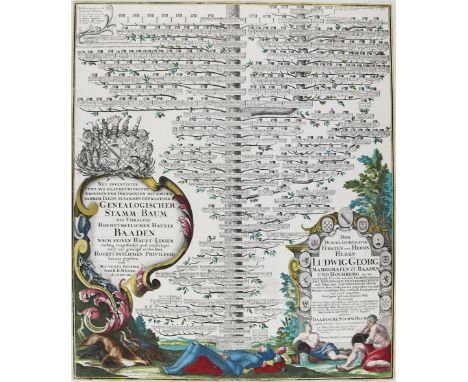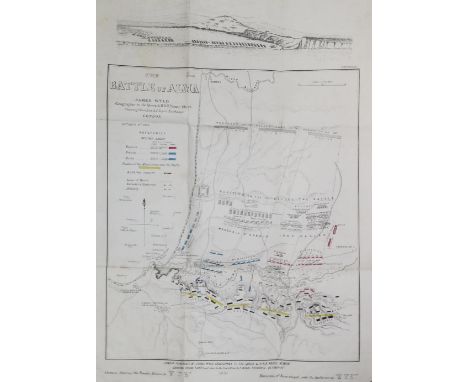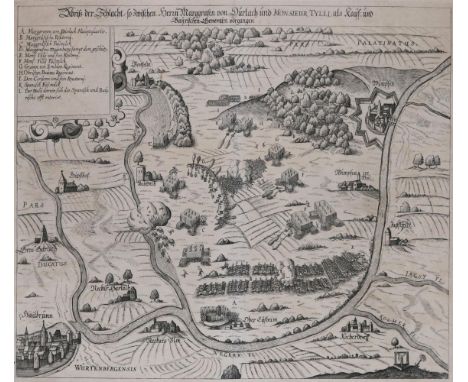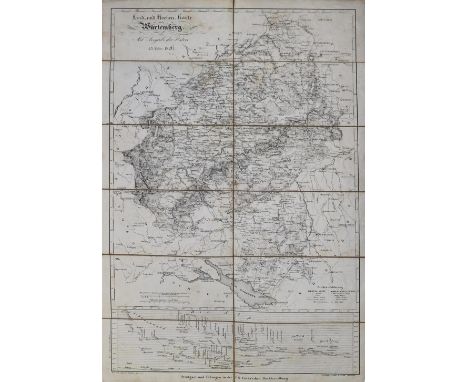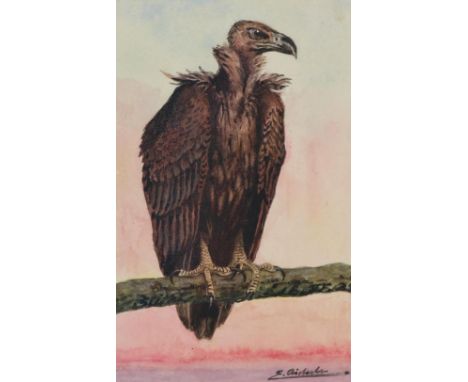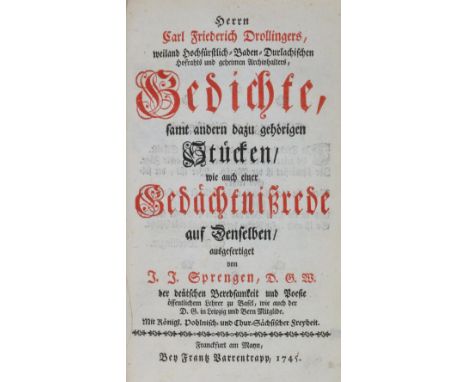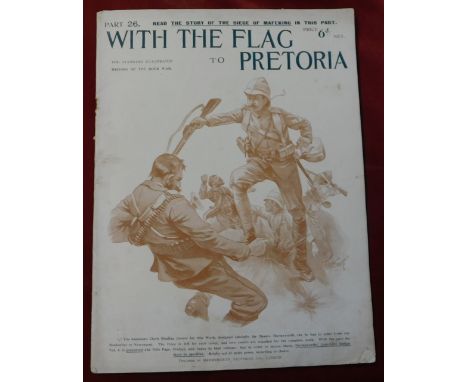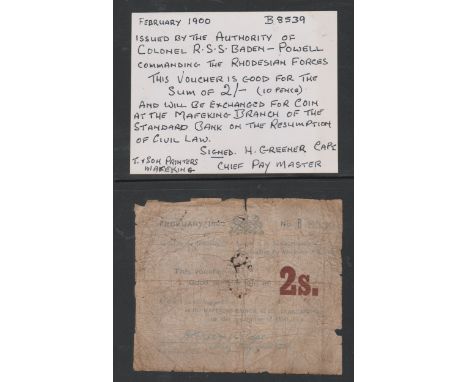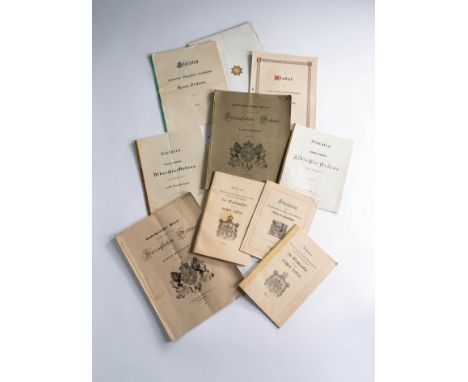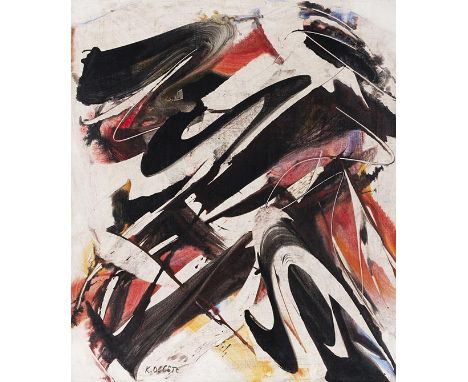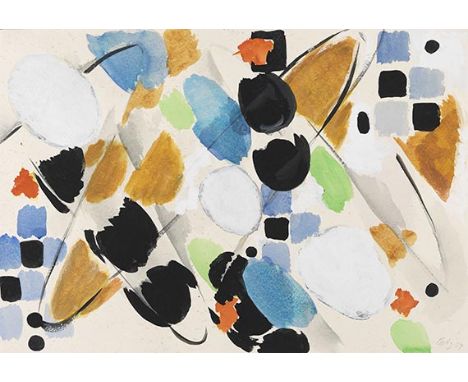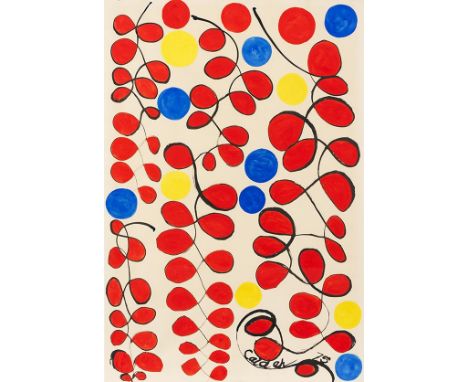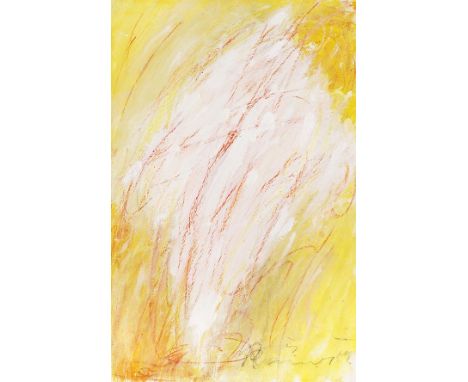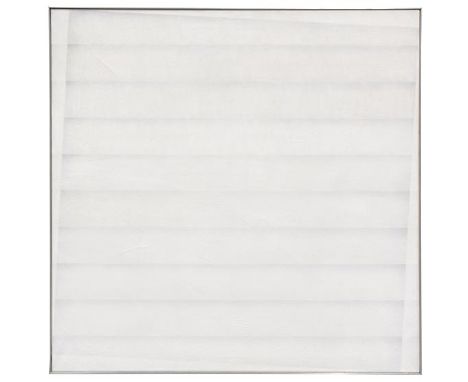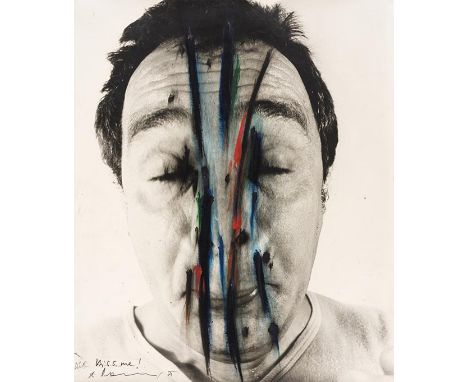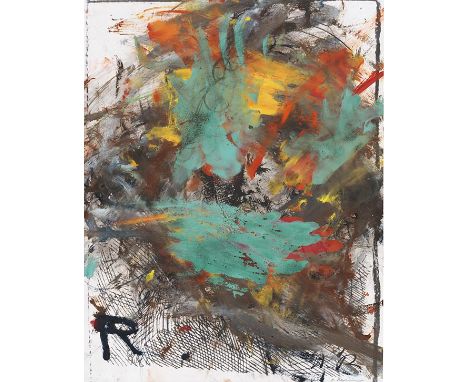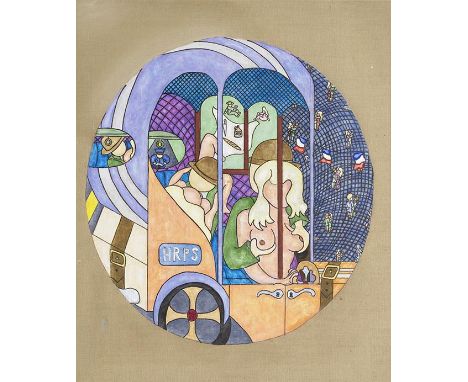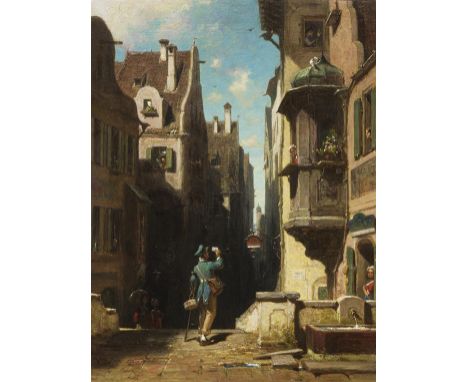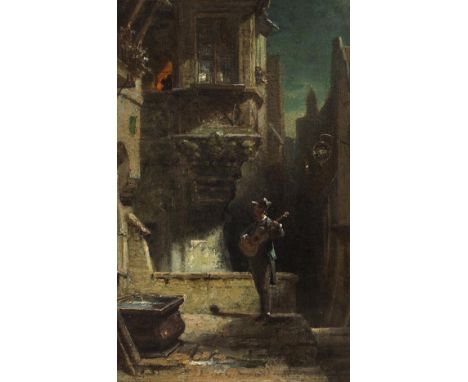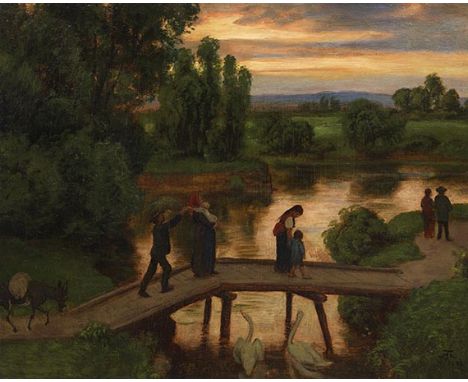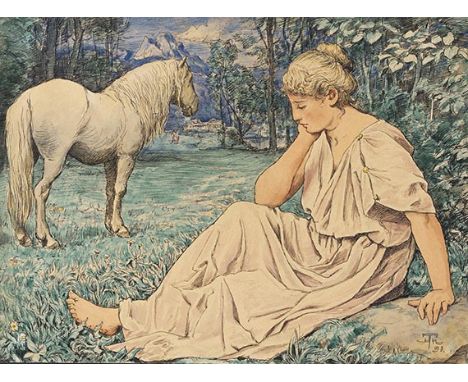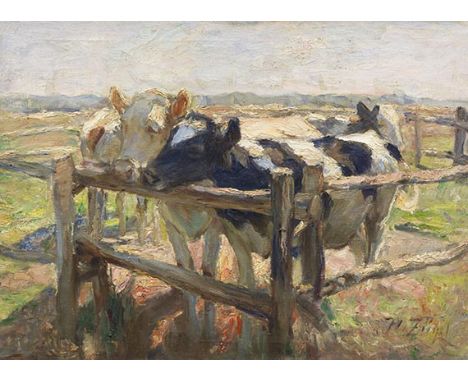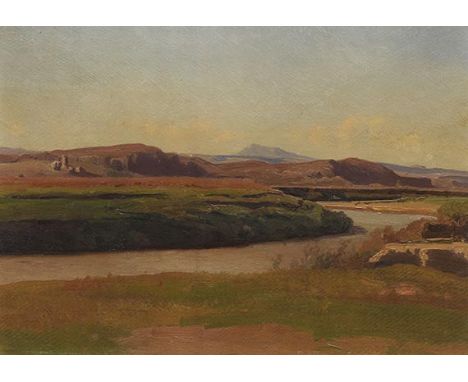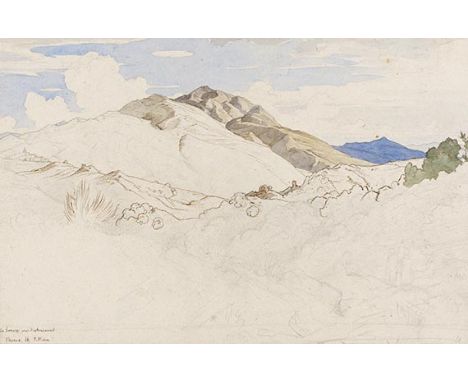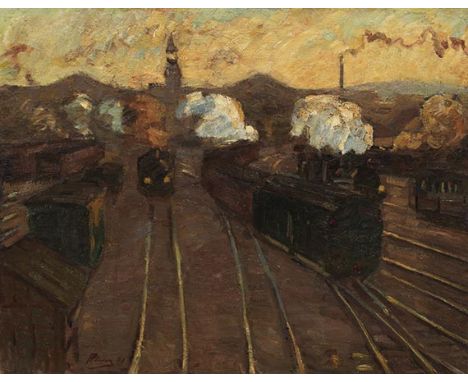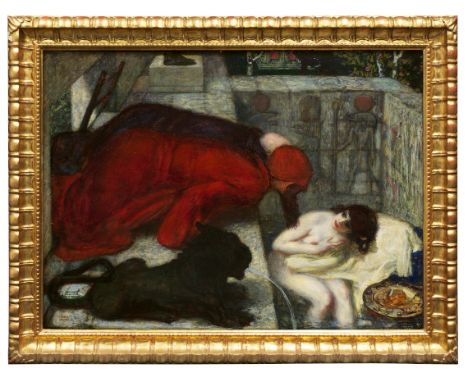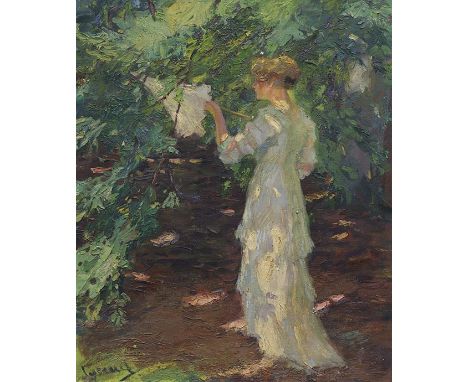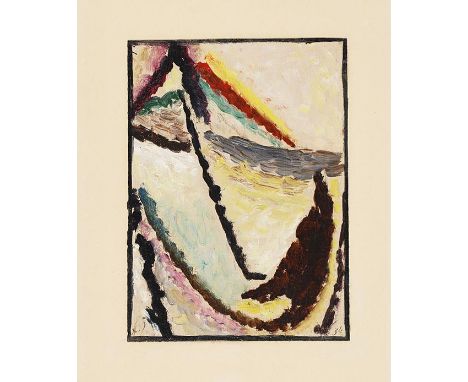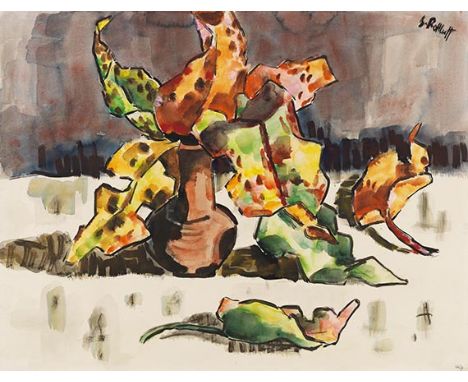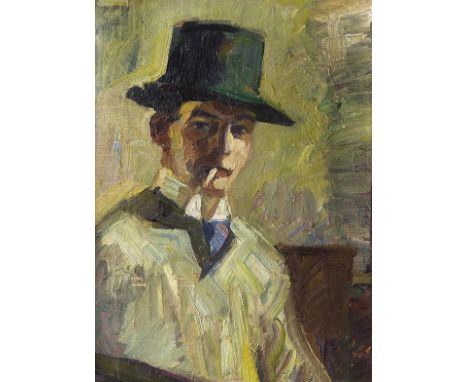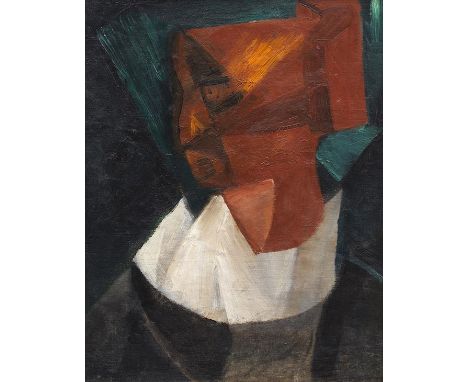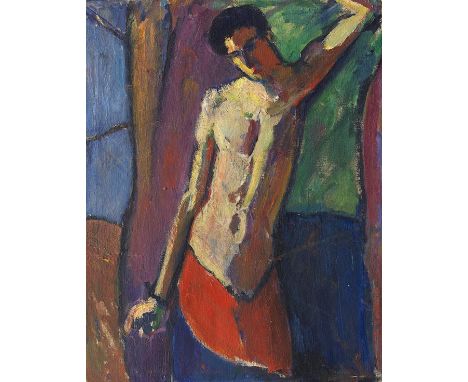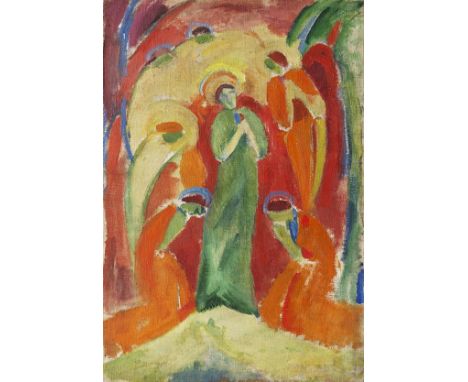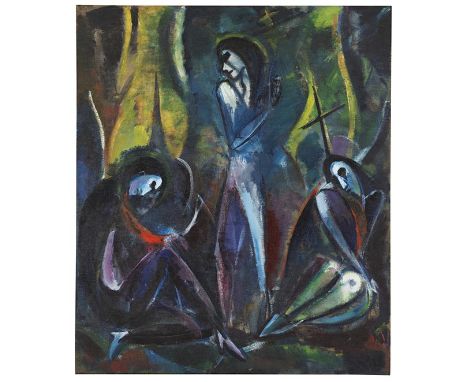9954 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen
9954 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.
Preisdatenbank abonnieren- Liste
- Galerie
-
9954 Los(e)/Seite
An interesting autograph album appearing to date from the 1940s wartime period and earlier, to include: signatures of the artist Augustus John, Prime Minister David Lloyd George, Composer Irving Berlin, Boxer Jack Petersen, King Leopold (whilst at Eton College), Lt. Gen. Sir Robert Baden-Powell, Godfrey Macdonald of the Isles (15th Baronet), a letter from General Lord Roberts, CB Fry, a personal letter from the cricketer W G Grace on London County Cricket Club Letterhead dated 1900, Queen Mary, a letter from Helen Moody, Sir Henry Irvin, Miss Ellaine Terriss and Mr Seymour Hicks, The Archbishop of Canterbury and others, some titled individuals. (B.P. 21% + VAT)
Moxon (Joseph or James). A collection of six Biblical Maps: Untitled double hemisphere map, one hemisphere being celestial, the other terrestrial, Paradise or the Garden of Eden with the Countries circumjacent Inhabited by the Patriarchs, Israels Perigrination. or the Forty Years Travels of the Children of Israel..., Canaan or the Land of Promise..., Travels of St. Paul and other the Apostles [and] Jerusalem, circa 1695, six double-page engraved maps with contemporary outline colouring, each map laid on near-contemporary card and bound 'back-to-back', heavily water stained, some maps split in half along the central fold, three with old sellotape staining scars to the central fold, each approximately 320 x 470 mm, later paper wrappers with late 19th-century ownership signature and title to upper cover, wrappers frayed and worn with crude tape repairs to the spine, overall size 445 x 285 mm, together with Munster (Sebastien). Designatio civitatis Badensis Helveticae, una cum oppidulo ther[marum], Basel [1554 or later], uncoloured woodblock plan of Baden, laid on later card, upper right corner torn with loss to title and image, crudely repaired, 280 x 345 mm, framed and glazed QTY: (2)NOTE:The first map described: R. W. Shirley. The Mapping of the World, number 549.
Kolb,J.B.: Historisch-statistisch-topographisches Lexicon von dem Großherzogthum Baden. 3 Bde. Karlsruhe, Macklot 1813-1816. Mit 1 Falttabelle. Neue Umschläge. Lautenschlager 573. - Einzige Ausgabe. Selten. - Titelbl. mit Siegelwachs-Resten. Tls. leicht fleckig. Bd. 1 mit eingehefteter Widmung vor Titel.
(Velten,J. Hrsg.).: Abbildungen der Regenten des Fürstlichen Hauses Baden. Mit biographischen Notizen zu den Abbildungen von A(loys) Schreiber. Karlsruhe, Velten 1829). 4°. Lithogr. Wappen, 46 lithogr. Porträts, Zwischentitel, 19 S. Hldr. d. Zt. mit floraler Rückenverg. Diepenbroick, Porträt-Katalog 937. - Einzige Ausgabe, selten. - Die Tafeln sind nach den Gemälden in den Schlössern zu Karlsruhe, Baden etc. lithographiert und zeigen die Regenten in ganzer Figur jeweils mit dem Wappen. Dargestellt sind u. a. Bertold I., Hermann I. (Markgraf von Baden), Bernhard II., Magaretha (Aebtissin zu Lichtenthal), Ottilia (Markgraf Christophs I. von Baden Gemahlin), Jacob II. (Erzbischof und Churfürst zu Trier), Carl Wilhelm (der Erbauer von Karlsruhe) etc. bis hin zum regierenden Herzog Ludwig. Mit ausführlichen biographischen Erläuterungen. - Rücken berieben und am Fuß mit kl. Fehlstelle, Deckel etwas fleckig, Innengelenke angeplatzt, ohne das lithogr. Titelblatt, St. einer Klosterbibliothek auf der ersten Tafel, durchgehend im Blattrand finger- und etwas braunfleckig, eine Tafel mit restauriertem Randeinriss, eine Tafel stärker braunfleckig, insgesamt noch ordentliches Exemplar der seltenen Porträtsammlung.
Baden.: "Neu inventirter... genealogischer Stamm-Baum des uhralten hochfürstlichen Hauses Baden". Stammbaum vom Juristen und Kardinal Giovanni Battista de Luca (1614-1683) verfasster umfassender Gesamtüberblick über das italienische Recht seiner Zeit. Das Werk galt sowohl unter katholischen, als auch protestantischen Juristen als bedeutendes Referenzwerk. Hier die zwischen 1688 und 1695 veröffentlichte Kölner Ausgabe. - Gebräunt u. fleckig, tls. wurmstichig. Ehemaliges Bibliotheksex.
Militärkarten.: 4 Schlachten- u. Fortifikationskarten, versch. Techniken u. Formate. ╔Enthält:╗ The Battle of Alma. Teilkolor. lithogr. Karte von J. Wyld, London 1854. 47 x 32 cm. - Topographische Karte des Kriegs- Theaters in Hessen, Baden und der Pfalz aus Hendschel bei Jügel, Ffm. o.J. 50 x 22 cm. - Plan der Revue-Manoeuvres in der Gegend zwischem Dijon und Couternon. Teilkolor. lithogr. Karte von Höllstein (?, unleserlich), O.O., Vlg. u. J. 44 x 37 cm. Etw. stärkere Gebrauchsspuren. - A Plan of the Town, Fortifications, and Citadel of Antwerp. Teilkolor. lithogr. Karte von J. Cross, London o.J. 38 x 55 cm. D
Baden-Württemberg.: Sammlung von 5 Karten Württemberg u. Baden in versch. Formaten u. Techniken, jwls. mehrf. gefalt. ╔Enthält:╗ Route von Strasburg bis Basel, Schaffhausen, den Bodensee und die Gegenden des Schwarzwaldes. Grenzkolor. Stahlst.-Karte O.O., Vlg. u.J. 37 x 42 cm. - Stuttgart mit Umgebung. Farb. lithogr. Karte bei Bohnert (Stgt.) 1870. Ca. 55 x 70 cm. - Die badischen Baeder, Spezial-Karte. Lithogr. v. Woerl bei Herder, Fbg. (um 1860). Ca. 55 x 50 cm. - Land- und Hoehen- Karte von Würtemberg mit Angabe der Posten. Lithogr. Karte v. Diezel bei Cotta, Stgt. u. Tbg. 1826. Ca. 50 x 32 cm. - Terrainkur und Touristenkarte der Umgebung Baden-Baden. Farb. lithogr. Karte v. F. Güther. O.O., Vlg. u.J. Ca. 62 x 50 cm. - Tls. etw. Gebrauchsspuren. D
Aichele, Erwin: (1887 Höhefeld/Baden - Pforzheim-Eutingen 1974). Mönchgeier oder Kuttengeier auf einem Ast sitzend. Aquarell. Blgr. 17,8 x 12 cm. Unt. re. sign. Auf grauen Karton aufgezogen u. dort verso auf hs. Etikett betitelt. Hinter Passep. ╔Dabei: Ders.╗ Schwarze Seeschwalbe auf einem Pfosten sitzend. Aquarell. Blgr. 18 x 12 cm. Unt. re. sign. Auf grauen Karton aufgez. u. dort verso hs. betitelt u. mit Druck-Anmerkungen. - Stellenw. etw. Wurmfraß.
Drollinger, Carl Friedrich.: Gedichte samt andern dazu gehörigen Stücken wie auch einer Gedächtnißrede auf denselben ausgefertiget von J.J. Sprengen. Ffm., Varrentrapp 1745. Mit gest. Front. und gest. Portrait von Heumann, 1 Wappenholzschnitt und zahlr. Holzschnitt-Vign. 6 Bl., LIV S., 3 Bl., 397 S. Ldr. d. Zt. mit goldgepr. Rckntitel a. rot. Rsch. u. floraler Rverg. Faber du Faur 1406. Vgl. Sammlung Neufforge 1075. Zweite Ausgabe. "Drollinger was a native of Baden who later became a member of the government of the canton of Basel. Switzerland soon claimed him for their own, in fact honored him as the Helvetian Opitz" (FdF). Postum veröffentlichte Gesamtausgabe mit dem schönen, allegorischen Frontispiz von Heumann nach J.R. Huber.
South African - Mafeking Feb 1900 Boer War Issued by the Authority of Colonel R.S.S. Baden-Powell commanding the Rhodesian Forces, the voucher is good for the sum of 2/- (10 pence) and will be exchanged for coimg, At the Mafeking Branch of the Standard Bank on the Relimption of Civil Law. Signed H. Greener Capt chief pay master, well used ewith faults, scarce
A GROUP OF 16 BRAZILIAN JAZZ, SOUL & FUNK VINYL RECORDS Including 4 x Baden Powell, Astrud Gilberto - September 17th 1969 (Verve), 6 x Deodato, 2 x Antonio Carlos Jobim, and 3 x Sergio Mendes Condition: For a condition report or further images please email hello@hotlotz.com at least 48 hours prior to the closing date of the auction. This is an auction of preowned and antique items. Many items are of an age or nature which precludes their being in perfect condition and you should expect general wear and tear commensurate with age and use. We strongly advise you to examine items before you bid. Condition reports are provided as a goodwill gesture and are our general assessment of damage and restoration. Whilst care is taken in their drafting, they are for guidance only. We will not be held responsible for oversights concerning damage or restoration.
A collection of mostly 19th century foreign coins to include some silver and billon: 1680 1 Öre Silvermynt; 3 x Malta grano (1757, 1750? and 1776); 2 x Morocco 1 falus (1854-60) 1914 and 1944 Swiss 1 franc; an 1866 2 rappen and a 1895 10 rappen; Austria ¼ florin; 1863 Italy 20 centesimi; 1803 2 skilling dansk and a 1868 1 silber groshen; 1915 France 50 centimes; 1844 Frankfurt 1 heller and a 1851 Austria 1 kreuzer; Baden 1864 and 1869 1 Kreuzer, 1848 3 kreuzer; 1863 Netherlands 1 cent; 1842 2½ silbergroshen; 1861 Nova Scotia 1 cent and a 1862 1⁄12 anna; 1831 Liberty cent and an 1833 Indian Head; 1 kurus (Ottoman Empire); Abdul Hamid II 40 and 20 para; 1819 Brazil 20 reis; 1866 Russia 5 kopeck; Napoleon III - 3 x 10c, 6 x 5c, 1 x 2c and 1 x 1c; Luxembourg 1865 10c and France 1872 10c.
Willi Baumeister 1889 Stuttgart - 1955 Stuttgart Ländliche Komposition (Violettes Bild). 1948. Öl, Kunstharz und Spachtelkitt auf Hartfaserplatte. Verso signiert, datiert 'Nov 48' und schwer leserlich bezeichnet. 53,7 x 64,6 cm (21,1 x 25,4 in). Im älteren Werkverzeichnis (Grohmann, 1963) als 'Ländliche Komposition' geführt, von Baumeister selbst im Sammelverzeichnis des Künstlers 'Violettes Bild' genannt. Bis zum 4. Februar 2024 zeigt das Museum Gunzenhauser in Chemnitz die umfassende Werkschau 'Das Kreative geht dem Unbekannten entgegen. Willi Baumeister und sein Netzwerk'. [CH]. • Aus der Hochphase von Baumeisters bedeutender Werkserie der 'Metaphysischen Landschaften' (1944–1954), die als Höhepunkt in Baumeisters künstlerischem Schaffen der Nachkriegsjahre gilt. • Seit fast 45 Jahren Teil einer süddeutschen Privatsammlung. • In diesen Arbeiten schafft der Künstler eine Symbiose aus Landschaftsbild und abstrakten Formenelementen. • Durch den Einsatz von Kunstharz und Spachtelmasse erzielt Baumeister eine eindrucksvolle haptische Oberflächenwirkung, die den prähistorischen Charakter seines archaisch anmutenden Formenrepertoires unterstreicht. • Im Entstehungsjahr stellt Baumeister auf der XXIV. Biennale von Venedig aus. • Vergleichbare Gemälde aus dieser Werkreihe der 'Metaphysischen Landschaften' befinden sich heute in bedeutenden öffentlichen Sammlungen, darunter das Centre Pompidou in Paris, die Hamburger Kunsthalle und das Städel in Frankfurt a. Main. PROVENIENZ: Sammlung Woldemar Klein, Baden-Baden (verso m. d. handschrift. Vermerk). Privatsammlung. Galerie Wolfgang Ketterer, München. Privatsammlung. Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia. Privatsammlung Frankfurt a. Main. Galerie Pels-Leusden, Berlin. Privatsammlung Süddeutschland (1980 vom Vorgenannten erworben). LITERATUR: Peter Beye/Felicitas Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, Bd. II, Ostfildern 2002, S. 553, WVZ-Nr. 1412 (m. SW-Abb.). Will Grohmann, Willi Baumeister. Leben und Werk, Köln 1963, WVZ-Nr. 1023. Hauswedell & Nolte, Hamburg, 214. Auktion, 2.-4.6.1976, Los 76 (m. Abb.). Galerie Wolfgang Ketterer, München, 36. Auktion, 26.-28.11.1979, Los 136 (m. Farbabb.). 'Einen Höhepunkt in der Entwicklung der vierziger Jahre bezeichnen die 'Metaphysischen Landschaften' [..].' Peter Beye, zit. nach: Beye/Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, Bd. I, S. 18. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.06 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONWilli Baumeister 1889 Stuttgart - 1955 Stuttgart Ländliche Komposition (Violettes Bild). 1948. Oil, synthetic resin and filler on fiberboard. Signed, dated 'Nov 48' and barely legible inscribed on the reverse. 53.7 x 64.6 cm (21.1 x 25.4 in). Mentioned as 'Ländliche Komposition' in the older catalogue raisonné (Grohmann, 1963), while Baumeister called it 'Violettes Bild' in his own collection index. Up until February 4 2024, the Museum Gunzenhauser in Chemnitz shows the comprehensive exhibition 'Das Kreative geht dem Unbekannten entgegen. Willi Baumeister und sein Netzwerk'. [CH]. • From the heyday of Baumeister's important series 'Metaphysical Landscapes' (1944-1954), which is considered the pinnacle of Baumeister's artistic oeuvre of the post-war era. • Part of a southern German private collection for almost 45 years. • In these works, the artist created a symbiosis of landscape and abstract formal elements. • By using synthetic resin and putty, Baumeister achieved an impressive haptic surface effect that emphasizes the prehistoric character of his seemingly archaic repertoire of forms. • Baumeister exhibited his work at the XXIV Venice Biennale in the year it was made. • Comparable paintings from this series are in important public collections like the Centre Pompidou in Paris, the Hamburger Kunsthalle and the Städel in Frankfurt am Main. PROVENANCE: Woldemar Klein Collection, Baden-Baden (with a note on the reverse). Private collection. Galerie Wolfgang Ketterer, Munich. Private collection. Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia. Private collection Frankfurt a. Main. Galerie Pels-Leusden, Berlin. Private collection Süouthern Germany (acquired from the above in 1980). LITERATURE: Peter Beye/Felicitas Baumeister, Willi Baumeister. Catalogue raisonné of paintings, vol. II, Ostfildern 2002, p. 553, no. 1412 (black-and-white illu.). Will Grohmann, Willi Baumeister. Leben und Werk, Cologne 1963, no. 1023. Hauswedell & Nolte, Hamburg, 214th auction, June 2 - 4, 1976, lot 76 (illu.). Galerie Wolfgang Ketterer, Munich, 36th auction, November 26 - 28, 1979, lot 136 (color illu.). 'The 'Metaphysical Landscapes' mark the apex of the development of the 1940s [..].' Peter Beye, cited in: Beye/Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, vol. I, p. 18. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.06 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Karl Otto Götz 1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald 5.8.53 / I. 1953. Mischtechnik auf Leinwand. Links unten signiert. Verso auf der Leinwand signiert, datiert 'Dez. 65' und bezeichnet 'Karin zugeeignet Dez 65'. Auf dem Keilrahmen mit dem Sammlungsstempel 'Sammlung K. O. Götz'. 70 x 60 cm (27,5 x 23,6 in). Auf dem Keilrahmen wohl von fremder Hand bezeichnet „BRACHE RUE DE L´ODÉON“. Pierre Brache war ein bekannter Pariser Sammler und Mäzen, der einige Werke von K. O. Götz gekauft hatte. Es kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sich dieses Bild tatsächlich in der Sammlung Brach befunden hat. [CH]. • Karl Otto Götz gehört zu den Protagonisten des deutschen Informel. • Gemeinsam mit Heinz Kreutz, Bernard Schultze und Otto Greis begründet er im Dezember 1952 – wenige Monate vor Entstehung unserer Arbeit – die Künstlergruppe 'Quadriga'. • 1952 entwickelt Götz zudem eine ganz eigene, neue Maltechnik mit Kleister, Gouachefarbe, Rakel und Pinsel, durch die er zu der für ihn charakteristischen informellen Malerei findet und die damit für sein gesamtes weiteres Schaffen ausschlaggebend sein wird. • Mit dem kraftvollen Pinselduktus und der gestischen Expressivität macht das Werk die rhythmischen Bewegungen des Künstlers während des Schaffensprozesses erfahrbar. • Bereits 1958 ist Götz mit seinen Arbeiten auf der XXIX. Biennale in Venedig vertreten, 1959 auf der II. documenta in Kassel. • Vergleichbare Arbeiten befinden sich in bedeutenden Museen und Institutionen, darunter die Nationalgalerie Berlin, das Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a. Main, die Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, und das Bundespräsidialamt in Berlin. Das Werk ist im Online-Werkverzeichnis der Leinwandbilder der K. O. Götz und Rissa-Stiftung unter der Nummmer WVL-1953-28 verzeichnet. Wir danken Herrn Joachim Lissmann für die freundliche wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Galerie Raymand Creuze, Paris (1954, auf dem Keilrahmen mit einem handschriftl. bezeichneten, durchgestrichenen Etikett). Privatsammlung Paris. Sammlung Prof. Karin Götz (ab 1965, verso auf der Leinwand bezeichnet). Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart. Galerie Maulberger, München. Privatsammlung Baden-Württemberg (vom Vorgenannten erworben). LITERATUR: Ina Ströher, K. O. Götz. Werkverzeichnis, Bd. I (1937-1979), Köln 2014, S. 114, WVZ-Nr. 1953-28 (m. Farbabb.). Manfred de la Motte (Hrsg.), K. O. Götz, Bonn 1978 (m. Abb. zwischen S. 232 u. 233). K. O. Götz, Erinnerungen und Werk, Bd. I a, Düsseldorf 1983, Kat.-Nr. 1 (m. Abb, S. 2 bzw. Frontispiz). 'Als ich im Sommer 1952 Kleisterfarben für meinen kleinen Sohn anrührte, fand ich quasi durch Zufall meine [..] Maltechnik: Erst Kleister auf's Papier, dann mit Gouache hinein, und fertig war das Bild [..]. Der Schritt vom Karton (Gouache) zur Leinwand ergab sich von selbst. So fand ich im Winter 1952/53 jene Technik und Konzeption, die die Faktur meiner Bilder fortan bestimmen sollte [..].' K. O. Götz, zit. nach: H. Zimmermann, in: Ausst.-Kat. K. O. Götz. Malerei 1935-1993, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1994, S. 12. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.14 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONKarl Otto Götz 1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald 5.8.53 / I. 1953. Mixed media on canvas. Lower left signed. Signed, dated 'Dez. 65' and inscribed 'Karin zugeeignet Dez 65'. With the stamp 'Sammlung K. O. Götz' on the stretcher. 70 x 60 cm (27.5 x 23.6 in). Inscribed 'BRACHE RUE DE L'ODÉON' on the stretcher, probably by a hand other than his own. Pierre Brache was a well-known Parisian collector and patron who had bought several works by K. O. Götz. However, it cannot be said with certainty whether this painting was actually in the Brach collection. [CH]. • Karl Otto Götz was one of the protagonists of German Informalism. • Together with Heinz Kreutz, Bernard Schultze and Otto Greis, he founded the artist group 'Quadriga' in December 1952 - just a few months before our work was created. • In 1952, Götz also developed his very own new painting technique using paste, gouache paint, squeegee and brush, which led him to his characteristic informal style of painting and would be decisive for the rest of his oeuvre. • With its powerful brushstrokes and gestural expressiveness, the work makes the artist's rhythmic movements of the creative process tangible. • Götz showed his works at the XXIX Venice Biennale in 1958 and in the II documenta in Kassel in 1959. • Comparable works can be found in important museums and institutions like the Nationalgalerie Berlin, the Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, the Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, and the Office of the Federal President in Berlin. The work is registered in the online catalogue raisonné of canvas pictures at K. O. Götz and Rissa Foundation with the number WVL-1953-28. We are grateful to Mr Joachim Lissmann for his kind expert advice. PROVENANCE: Galerie Raymand Creuze, Paris (1954, with an inscribed and crossed out label on the stretcher). Private collection Paris. Collection of Prof. Karin Götz (from 1965, inscribed on the reverse). Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart. Galerie Maulberger, Munich. Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above). LITERATURE: Ina Ströher, K. O. Götz. Catalogue raisonné, vol. I (1937-1979), Cologne 2014, p. 114, no. 1953-28 (color illu.). Manfred de la Motte (ed.), K. O. Götz, Bonn 1978 (fig between pp. 232 and 233). K. O. Götz, Erinnerungen und Werk, vol. I a, Düsseldorf 1983, cat. no. 1 (fig., p. 2 and frontispiece). 'When I was mixing paste paint for my little son in the summer of 1952, I found my [..] painting technique almost by chance: first put paste on the paper, then gouache into it, and the picture was finished [..]. The step from cardboard (gouache) to canvas came about naturally. Thus, in the winter of 1952/53, I found the technique and concept that would determine the structure of my paintings from then on [..].' K. O. Götz, quoted from: H. Zimmermann, in: ex. cat. K. O. Götz. Malerei 1935-1993, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1994, p. 12. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.14 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Ernst Wilhelm Nay 1902 Berlin - 1968 Köln Ohne Titel. 1954. Gouache. Claesges 54-008. Rechts unten signiert und datiert. Auf festem Aquarellpapier. 41,8 x 60,3 cm (16,4 x 23,7 in), blattgroß. [CH]. • Eine der ersten Arbeiten, in denen Nay zu seiner legendären Scheibenform findet, mit der er seine so bedeutende Werkphase der 'Scheibenbilder' (1954–1962) einläutet. • Außergewöhnlich fein modulierte Rhythmik der grafischen und geometrischen Elemente und Scheiben-Formen. • Ehemals Teil der renommierten Sammlung Bernhard Sprengel, Hannover. • 1955 und 1956 ist Nay mit seinen Scheibenbildern auf der documenta I in Kassel und auf der XXVIII. Biennale di Venezia vertreten. PROVENIENZ: Sammlung Bernhard Sprengel (1899-1985), Hannover. Galerie Heseler, München. Privatsammlung Baden-Württemberg. Privatsammlung Baden-Württemberg (2014 vom Vorgenannten erworben, Ketterer Kunst, München, Los 802). LITERATUR: Magdalene Claesges, Ernst Wilhelm Nay. Werkverzeichnis. Aquarelle - Gouachen - Zeichnungen, Bd. 3: 1954-1968, Berlin 2018, S. 25, WVZ-Nr. 54-008 (m. Farbabb.). Hauswedell & Nolte, Hamburg, 283. Auktion, 9.6.1990, Los 261 (m. Abb., Tafel 21). Ketterer Kunst, München, 420. Auktion, 6.12.2014, Los 802 (m. Farbabb.). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.17 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONErnst Wilhelm Nay 1902 Berlin - 1968 Köln Ohne Titel. 1954. Gouache. Claesges 54-008. Lower right signed and dated. On firm watercolor paper. 41.8 x 60.3 cm (16.4 x 23.7 in), the full sheet. [CH]. • One of the first works in which Nay found his legendary disk form, with which he began his important work phase of the 'Disk Pictures' (1954-1962). • Exceptional subtly modulated rhythm of graphic and geometric elements and disk shapes. • Formerly part of the renowned Bernhard Sprengel Collection, Hanover. • In 1955 and 1956, Nay exhibited his Disk Paintings at documenta I in Kassel and at the XXVIII. Biennale di Venezia. PROVENANCE: Bernhard Sprengel Collection (1899-1985), Hanover. Galerie Heseler, Munich. Private collection Baden-Württemberg. Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above in 2014, Ketterer Kunst, Munich, lot 802). LITERATURE: Magdalene Claesges, Ernst Wilhelm Nay. Catalogue raisonné. Aquarelle - Gouachen - Zeichnungen, vol. 3: 1954-1968, Berlin 2018, p. 25, no. 54-008 (color illu.). Hauswedell & Nolte, Hamburg, 283rd auction, June 9, 1990, lot 261 (fig., plate 21). Ketterer Kunst, Munich, 420th auction, December 6, 2014, lot 802 (color illu.). Called up: December 8, 2023 - ca. 13.17 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Alexander Calder 1898 Philadelphia - 1976 New York Sweet peas. 1975. Gouache und Tusche. Rechts unten signiert und datiert. Verso handschriftlich bezeichnet 'Sweet Peas' und '14 6 81'. Auf Velin von Canson (mit dem Trockenstempel). 110 x 74,5 cm (43,3 x 29,3 in), Blattgröße. [EH]. • Alexander Calder ist einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. • In seiner Gouache übersetzt er die Bewegung im Raum in Linie und Fläche auf Papier. • Sein Werk ist sehr vielfältig: 1975 gestaltet er auch das erste BMW Art Car. • Alexander Calder war 1955 Teilnehmer der documenta 1 sowie ebenso auf den beiden documenta-Ausstellungen 1959 und 1964 vertreten. PROVENIENZ: Galerie Maeght, Zürich (verso mit dem Etikett). Privatsammlung Basel. Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.37 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONAlexander Calder 1898 Philadelphia - 1976 New York Sweet peas. 1975. Gouache and India ink. Lower right signed and dated. With the inscriptions 'Sweet Peas' and '14 6 81' on the reverse. On Canson wove paper (with the blindstamp). 110 x 74.5 cm (43.3 x 29.3 in), size of sheet. [EH]. • Alexander Calder is one of the most important sculptors of the 20th century. • In the gouache, he transfers the movement in space into line and surface on paper. • His work is very diverse: in 1975 he also designed the first BMW Art Car. • Alexander Calder was a participant in documenta 1 in 1955, as well as in the two subsequent documenta exhibitions in 1959 and 1964. PROVENANCE: Galerie Maeght, Zürich (with the label on the reverse). Private collection Basel. Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.37 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Übermalung. 1959. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert und datiert. 38,5 x 24,5 cm (15,1 x 9,6 in). [EH]. • Arnulf Rainer zählt zu den wichtigsten Künstlern der österreichischen Avantgarde nach 1945. • Von außergewöhnlich leuchtender Strahlkraft. • Die Übermalung gilt bis heute als das zentrale Prinzip in Rainers Schaffen und als kunsthistorisch bedeutender Beitrag zur europäischen Nachkriegskunst. • Im Entstehungsjahr ist Rainer auf der documenta II in Kassel vertreten. PROVENIENZ: Privatsammlung Österreich. 'Rainer malt seine eigene Individualität aus den Bildern heraus, aber er versucht gerade dadurch den Bildern eine eigene Individualität zu geben: etwas Flaches, Pralles, Weiches, Dichtes, Bewegtes, Ausfließendes oder Stilles.' Dieter Honisch, in: Ausst.-Kat. Arnulf Rainer, Nationalgalerie Berlin u. a., 1980/81, S. 46. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.44 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Übermalung. 1959. Oil on canvas. Lower right signed and dated. 38.5 x 24.5 cm (15.1 x 9.6 in). [EH]. • Arnulf Rainer is one of the most important artists of the Austrian post-war avant-garde • Of extraordinary luminosity. • Overpainting is still considered the central principle of Rainer's work and a significant contribution to European post-war art. • Rainer was represented at documenta II in Kassel in the year this work was created. PROVENANCE: Private collection Austria. 'Rainer paints his own individuality out of the pictures, but he tries to give the pictures their own individuality precisely by doing so: something flat, plump, soft, dense, moving, flowing or calm.' Dieter Honisch, in: ex. cat. Arnulf Rainer, Nationalgalerie Berlin et al, 1980/81, p. 46. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.44 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Raimund Girke 1930 Heinzendorf/Schlesien - 2002 Köln Ohne Titel. 1967. Öl auf Leinwand. Auf der umgeschlagenen Leinwand signiert, datiert, betitelt und bezeichnet 'oben' sowie mit Richtungspfeil. 100 x 100 cm (39,3 x 39,3 in). [JS]. • Frühe Arbeit im charakteristischen, minimalistischen Girke-Stil. • Girke ist ein Meister der monochromen Malerei: Während sein Œuvre um 1960 noch von den Nichtfarben Schwarz und Weiß beherrscht wird, erreicht er ab den späten 1960er Jahren eine maximale Nuancierung des Weiß. • 'Ohne Titel' erklärt die Nichtfarbe Weiß in all ihren Schattierungen und Ausdrucksebenen zum Protagonisten der sanft durchmodulierten Komposition. • Durch die rhythmische Struktur und Nuancierung lässt Girke die faszinierende Illusion von Dreidimensionalität und Bewegung entstehen. • 2022 würdigte das MKM Museum Küppersmühle, Duisburg, Girkes Œuvre unter dem Titel 'Raimund Girke. Klang der Stille' mit einer großen Retrospektive. PROVENIENZ: Galerie Teufel, Koblenz. Privatsammlung Baden-Württemberg (1971 vom Vorgenannte erworben, seither in Familienbesitz). AUSSTELLUNG: Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, o. J. (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett). 'Die horizontalen Streifen heben sich von dem Weiß der Bildfläche ab, indem sie sich aus einer oben liegenden helleren und einer unteren, verschatteten Zone zusammensetzen. Dadurch ergibt sich die räumliche Illusion, die Leinwände würden sich an den Horizontalen dem Betrachter entgegenwölben. Gleichzeitig ensteht auf der Fläche eine Art virtueller Bewegung. Die Abstände der Linien variieren, so daß der Bildkörper sich in bestimmten Bereichen auszudehnen, in anderen zusammenzuziehen scheint, vergleichbar einem lebenden, atmenden Organismus. Der Auftrag mit der Spritzpistole ermöglicht subtilste Farbverläufe, wobei sich das Weiß als ein zarter, diaphaner Nebel über die Leinwand legt.' Dietmar Elger, Raimund Girke. Malerei, Bonn 1995, S. 66. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.08 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONRaimund Girke 1930 Heinzendorf/Schlesien - 2002 Köln Ohne Titel. 1967. Oil on canvas. Signed, dated and titled as well as inscribed 'oben' and with a direction arrow on the reverse. 100 x 100 cm (39.3 x 39.3 in). [JS]. • Early work in the characteristic, minimalist Girke style. • Girke is a master of monochrome painting: while his œuvre around 1960 was still dominated by the non-colors black and white, he had achieved a maximum nuance of white since the late 1960s . • 'Untitled' declares the non-color white in all its shades and levels of expression as the protagonist of the gently modulated composition. • Through rhythmic structure and nuance, Girke creates a fascinating illusion of three-dimensionality and motion. • In 2022, the MKM Museum Küppersmühle, Duisburg, honored Girke's œuvre with a major retrospective titled 'Raimund Girke. Klang der Stille' (Sound of Silence). PROVENANCE: Galerie Teufel, Koblenz. Private collection Baden-Württemberg (acquired from te above in 1971, ever since family-owned). EXHIBITION: Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, no date (with the label on the stretcher). 'The horizontal stripes stand out against the picture's white surface as they are composed of a lighter zone on top and a shadowed zone underneath. This creates the spatial illusion as if the canvases were curving towards the viewer on the horizontal lines. At the same time, a kind of virtual motion is created on the surface. The distances between the lines vary, so that the body of the painting seems to expand in certain areas and contract in others, comparable to a living, breathing organism. The application with the spray gun allows for the most subtle color gradients, with the white falls onto the canvas as a delicate, diaphanous mist.' Dietmar Elger, Raimund Girke. Malerei, Bonn 1995, p. 66. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.08 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Heinz Mack 1931 Lollar/Hessen - lebt und arbeitet in Mönchengladbach und auf Ibiza Pyramide im Licht Chromatische Konstruktion. 1994. Acryl auf Leinwand. Verso signiert, datiert und mit Richtungspfeil. Auf dem Keilrahmen betitelt. 45 x 55 cm (17,7 x 21,6 in). [SM]. • Seit den frühen 1990er Jahren widmet sich Mack wieder intensiv der Malerei. • Inspiriert durch die Sonnenfarben seines Ateliers auf Ibiza. • Erst kürzlich zeigte das Museum Kunstpalast, Düsseldorf, eine groß angelegte Retrospektive seines Schaffens (2021) und in diesem Jahr widmet das Osthaus Museum in Hagen allein seiner Malerei eine umfassende Einzelausstellung. Mit einem Zertifikat des Atelier Heinz Mack, Mönchengladbach, vom September 2015. PROVENIENZ: Galerie Hoffmeister, Lüdenscheid (verso mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Baden-Württemberg (seit 2016). LITERATUR: Ketterer Kunst, München, 433. Auktion, 11.6.2016, Los 987. Inspiriert durch die Sonnenfarben seines Ateliers auf Ibiza, widmet sich Mack ab 1991 wieder intensiv der Malerei, nennt seine Werke 'Chromatische Konstellationen'. Heinz Mack gilt als unermüdlicher Experimentator im Spektrum des Farblichts. Als Maler, Zeichner, Skulpturenkünstler, Keramiker, aber auch als Gestalter von Plätzen und Interieurs stellt er die ästhetischen Gesetze von Licht und Farbe, Struktur und Form in immer neue Dialoge. Die vorliegende Arbeit reiht sich mit ihrer immateriellen Farb-und Bildauffassung nahtlos in diese Serie ein, in Bildräume voller Leuchtintensität und Farbreinheit. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.12 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONHeinz Mack 1931 Lollar/Hessen - lebt und arbeitet in Mönchengladbach und auf Ibiza Pyramide im Licht Chromatische Konstruktion. 1994. Acrylic on canvas. Signed, dated and with a direction arrow on the reverse. Titled on the stretcher. 45 x 55 cm (17.7 x 21.6 in). [SM]. • After a longer break, Mack devoted himself to painting again in the early 1990s. • Inspired by the sunny colors of his studio on Ibiza. • The Museum Kunstpalast, Düsseldorf, recently presented a major retrospective of his work (2021) and this year, the Osthaus Museum in Hagen is devotes a comprehensive solo exhibition exclusively to his paintings. Accompanied by a certificate of authenticity issued by the Atelier Heinz Mack, Mönchengladbach, in September 2015. PROVENANCE: Galerie Hoffmeister, Lüdenscheid (gallery label on the verse). Private collection Baden-Württemberg (since 2016). LITERATURE: Ketterer Kunst, Munich, 433rd auction, June 11, 2016, lot 987. Inspired by the sunny colors of his studio on Ibiza, Mack returned to painting in 1991, calling his works 'Chromatic Constellations'. Heinz Mack is regarded a tireless experimenter in the spectrum of colored light. As a painter, draftsman, sculptor, ceramist, but also as a designer of squares and interiors, he constantly engages in new dialogues with the aesthetic laws of light and color, structure and form. With its immaterial conception of color and image, the present work fits into this series, into pictorial spaces full of luminous intensity and pure colors. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.12 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Don't kiss me. 1971. Mischtechnik über Fotografie. Links unten signiert, datiert und betitelt. Verso erneut betitelt und datiert. Auf glattem, festen Velin. 60,9 x 50,5 cm (23,9 x 19,8 in), Blattgröße. [AW]. • Expressive Verbindung von Fotografie und Malerei. • Prägnante Arbeit des berühmten österreichischen Künstlers, der in seinem Œuvre mit der Motivik des Verdeckens und Überlagerns spielt. • Arnulf Rainer ist Autodidakt, nach nur wenigen Tagen verlässt er die Wiener Akademie der Bildenden Künste wegen künstlerischer Kontroversen. • 1978 und 1980 vertritt Arnulf Rainer Österreich auf der Biennale in Venedig. Wir danken dem Studio Rainer für die wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Privatsammlung Süddeutschland. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.24 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Don't kiss me. 1971. Mixed media over a photograph. Lower left signed, dated and titled. Once again titled and dated on the reverse. On smooth firm wove paper. 60.9 x 50.5 cm (23.9 x 19.8 in), size of sheet. [AW]. • Expressive combination of photography and painting. • A striking work by the famous Austrian artist, who plays with the motifs of concealment and superimposition in his oeuvre. • Arnulf Rainer is an autodidact and left the Vienna Academy of Fine Arts after only a few days due to artistic controversy. • In 1978 and 1980, Arnulf Rainer represented Austria at the Venice Biennale. We are grateful to the Studio Rainer for the kind expert advice. PROVENANCE: Private collection Southern Germany. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.24 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Ohne Titel (Rembrandt). 1980/81. Mischtechnik über Fotografie. Rechts unten monogrammiert und signiert. Auf glattem Velin. 59 x 46,2 cm (23,2 x 18,1 in), blattgroß. [CH]. • Die 'Rembrandt-Übermalungen' sind den Serien der 'Kunst über Kunst' zuzuordnen, in denen Arnulf Rainer Reproduktionen alter Meister übermalt. • Auf charakteristische Weise verbindet der Künstler Fotografie und Malerei. • Seine malerische Verfremdung zerstört das zugrunde liegende Werk nicht, sondern verändert und erhöht durch den expressiven, kräftig-bunten Farbauftrag die Ausdruckskraft des Bildes. • Rainers Übermalungen gelten bis heute als das zentrale Prinzip seines Schaffens und als kunsthistorisch bedeutender Beitrag zur europäischen Nachkriegskunst. Wir danken dem Studio Rainer für die wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Munro Galerie, Hamburg. Privatsammlung Süddeutschland. AUSSTELLUNG: Arnulf Rainer. Rembrandt-Übermalungen 1980/81, Munro Galerie, Hamburg, 18.9.-30.11.1981, Kat.-Nr. 2 (m. ganzs. SW-Abb.). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.50 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Ohne Titel (Rembrandt). 1980/81. Mixed media over a photograph. Lower right monogrammed and dated. On smooth wove paper. 59 x 46.2 cm (23.2 x 18.1 in), the full sheet. [CH]. • The 'Rembrandt Overpaintings' are part of the 'Art about Art' series, in which Arnulf Rainer paints over Odd Master reproductions. • The artist combines photography and painting in a characteristic way. • His painterly alienation does not destroy the underlying work, but changes and enhances the picture's expressiveness through the application of the radiant colors. • Rainer's overpaintings are regarded the central principle of his work and a significant contribution to European post-war art. We are grateful to the Studio Rainer for the kind expert advice. PROVENANCE: Munro Galerie, Hamburg. Private collection Southern Germany. EXHIBITION: Arnulf Rainer. Rembrandt-Übermalungen 1980/81, Munro Galerie, Hamburg, September 18 - November 30, 1981, cat. no. 2 (full-page illu. in black and white). Called up: December 8, 2023 - ca. 14.50 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
William N. Copley 1919 New York - 1996 Key West/Florida Moving Violation. 1983. Acryl auf Leinwand. In der Darstellung (unten mittig) signiert 'Cply' und datiert. 171 x 141 cm (67,3 x 55,5 in). [CH]. • In dieser wie in vergleichbaren Arbeiten von 1983/84 verbindet Copley die unbemalte, großporige Leinwand mit Motiven einer sonntäglichen Spazierfahrt und bukolisch-idyllischem Picknicken im Grünen – von seiner Zeit in Paris (1951–1962) inspirierte französische Bildelemente sowie erotisch aufgeladene Figurenszenen in seiner charakteristisch bunten, intensiven Farbigkeit. • Die ovale Bildfläche füllt Copley mit mehreren Bilddimensionen und scheinbar parallel verlaufenden Geschichten sowie kleineren eigenständigen Darstellungen innerhalb der Gesamtkomposition. • Erst im Frühjahr diesen Jahres zeigt die Galerie Max Hetzler in der Ausstellung 'William N. Copley. Autoeroticism (Paintings from 1984)' in Paris Arbeiten aus eben dieser Werkserie. • Mit seinem einzigartigen künstlerischen Schaffen erzielt Copley eine Symbiose aus amerikanischer Pop-Art und europäischem Surrealismus und beeinflusst die Nachkriegskunst in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa nachhaltig. • Arbeiten des Künstlers aus den 1980er Jahren befinden sich u. a. im Museum of Modern Art in New York, im Museum für moderne Kunst / Mumok in Wien und im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. PROVENIENZ: David Nolan Gallery, New York. Galerie Fred Jahn, München (vom Vorgenannten erworben). Galerie Kurt Schäfer, Berlin (auf dem Keilrahmen mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Süddeutschland. AUSSTELLUNG: William N. Copley, Phyllis Kind Gallery, New York, 15.10.-19.11.1983 (auf d. Keilrahmen m. d. Galerieetikett). Wohl: CPLY, Phyllis Kind Gallery, Chicago, 6.1.-7.2.1984. 'It's always been the most important image that I've ever had simply because to me, the car is the stationary center of the universe. You're stationary, and the world is moving around you – over you, under you, around you. […] I find I could say more with that image than almost anything I've tried.' William N. Copley, 1983, in: Ausst.-Kat. William N. Copley, Fondazione Prada, Mailand 2016, S. 39. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.18 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONWilliam N. Copley 1919 New York - 1996 Key West/Florida Moving Violation. 1983. Acrylic on canvas. Signed 'Cply' and dated in the image (bottom center). 171 x 141 cm (67.3 x 55.5 in). [CH]. • In this work, as in comparable works from 1983/84, Copley combines the unpainted, large-pored canvas with motifs of a Sunday drive and bucolic, idyllic picnics in the countryside - French pictorial elements inspired by his time in Paris (1951-1962) as well as erotically charged figure scenes in his characteristically bright, intense colors. • Copley fills the oval image area with several pictorial dimensions and seemingly parallel stories as well as smaller, independent depictions within the overall composition. • Just this spring, Galerie Max Hetzler showed works from this very series in the exhibition 'William N. Copley. Autoeroticism (Paintings from 1984)' in Paris . • With his unique artistic oeuvre, Copley achieved a symbiosis of American Pop Art and European Surrealism and had a lasting influence on post-war art in the United States and Europe. • Works by the artist from the 1980s can be found in, among others, the Museum of Modern Art in New York, the Museum of Modern Art / Mumok in Vienna and the Museum Frieder Burda in Baden-Baden. PROVENANCE: David Nolan Gallery, New York. Galerie Fred Jahn, Munich (acquired from the above). Galerie Kurt Schäfer, Berlin (gallery label on the stretcher). Private collection Southern Germany. EXHIBITION: William N. Copley, Phyllis Kind Gallery, New York, October 15 - November 19, 1983 (gallery label onthe stretcher). Wohl: CPLY, Phyllis Kind Gallery, Chicago, January 6 - February 7, 1984. 'It's always been the most important image that I've ever had simply because to me, the car is the stationary center of the universe. You're stationary, and the world is moving around you – over you, under you, around you. […] I find I could say more with that image than almost anything I've tried.' William N. Copley, 1983, in: ex. cat. William N. Copley, Fondazione Prada, Milan 2016, p. 39. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.18 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Isa Genzken 1948 Bad Oldesloe - lebt und arbeitet in Köln Weltempfänger 'Goldi'. 1992. Teleskopantenne in Gussbeton. Auf der Unterseite signiert und betitelt sowie schwer lesbar datiert. Ohne Antenne: 18,5 x 12 x 5 cm (7,2 x 4,7 x 1,9 in). Die Gesamtmaße sind variabel, je nachdem, wie weit die Antenne ausgefahren wird. [AR]. • Kompaktes Skulptur-Unikat aus einer der gesuchtesten Werkgruppen der einflussreichen, deutschen Künstlerin. • Durch den Materialmix schafft sie spielerisch neue Sinnzusammenhänge, Sender und Empfänger werden ihrer grundlegenden Funktionen beraubt. • Die Neue Nationalgalerie in Berlin widmete der Künstlerin 2023 eine große Einzelausstellung, unter den Exponaten befanden sich auch Weltempfänger. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen. Wir danken der Galerie Buchholz, Köln, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Galerie Buchholz, Köln. Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.32 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONIsa Genzken 1948 Bad Oldesloe - lebt und arbeitet in Köln Weltempfänger 'Goldi'. 1992. Retractable antenna in cast concrete. Underside signed, titled and barely legibly dated. Without antena: 18.5 x 12 x 5 cm (7.2 x 4.7 x 1.9 in). Variable total dimensions owing to the retractable antena. [AR]. • Compact, unique sculpture from one of the most sought-after groups of works by the influential German artist. • Through the mix of materials, she playfully creates new contexts of meaning, depriving the sender and receiver of their basic functions. • The Neue Nationalgalerie in Berlin dedicated a major solo exhibition to the artist in 2023, which also included a Weltempfänger. The work will be included in the forthcoming catalogue raisonné. We are grateful to Galerie Buchholz, Cologne, for their kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Galerie Buchholz, Cologne. Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.32 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Ursula Schultze-Bluhm 1921 Mittenwalde - 1999 Köln La dompteuse. 1995. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert und datiert. Verso auf dem Keilrahmen erneut signiert und datiert sowie betitelt. 140 x 160 cm (55,1 x 62,9 in). [AR]. • Ursulas schaurige Fantasiewelten sind voller Kraft und Selbstbewusstsein. • Furchtlos erscheint die Dompteuse mit ihren wilden Kreaturen und lässt biografische Bezüge erahnen. • Seit der Entstehung 1995 in Privatbesitz. • Ausgestellt in der großen Retrospektive der Künstlerin 2023 im Museum Ludwig in Köln. • Mit ihren vielschichtigen oft mythologischen Arbeiten zählt sie zu den wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation. PROVENIENZ: Galerie Darthea Speyer, Paris (verso m. Etikett). Privatsammlung Baden-Württemberg (vom Vorgenannten erworben). AUSSTELLUNG: Galerie der Stadt Kornwestheim, 1997. Ursula. Das bin ich. Na und?, Museum Ludwig, Köln, 18.3.-23.7.2023, S. 360f. (m. Farbabb.). 'Ich zwinge meine Visionen der Realität auf – ich bin ganz artifiziell.' Ursula Schultze-Bluhm, zit. nach: Stephan Diederich (Hrsg.), Ursula. Das bin ich. Na und?, Köln 2023, S. 11. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.48 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONUrsula Schultze-Bluhm 1921 Mittenwalde - 1999 Köln La dompteuse. 1995. Oil on canvas. Lower right signed and dated. Once more signed and dated as well as titled on the reverse. 140 x 160 cm (55.1 x 62.9 in). [AR]. • Ursula's eerie fantasy worlds are full of power and self-confidence. • The tamer of the wild creatures appears fearless, a biographical references. • Privately owned since its creation in 1995. • Exhibited in the artist's major retrospective at the Museum Ludwig in Cologne in 2023. • With her compley, often mythological works, she is one of the most important artists of her generation. PROVENANCE: Galerie Darthea Speyer, Paris (with the lable on the reverse). Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above). EXHIBITION: Galerie der Stadt Kornwestheim, 1997. Ursula. Das bin ich. Na und?, Museum Ludwig, Cologne, March 18 - July 23, 2023, pp. 360f. (color illu.). 'I force my visions onto reality - I am completely artificial.' Ursula Schultze-Bluhm, quoted in: Stephan Diederich (ed.), Ursula. Das bin ich. Na und?', Cologne 2023, p. 11. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.48 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Karin Kneffel 1957 Marl - lebt und arbeitet in Düsseldorf und München Ohne Titel. 2003. Öl auf Leinwand. Verso signiert und datiert. 50 x 60 cm (19,6 x 23,6 in). • Typisch für Kneffel ist die fotorealistische Malweise mit Momenten der Irritation. • In raffinierter optischer Illusion scheint sich die Dogge aus ihrem eigenen Fellmuster herauszubewegen. • Aus der Werkserie zu Beginn der 2000er, in der Hunde in variierenden Posen zum Hauptmotiv erhoben werden. • Von 2008 bis 2022 hält Kneffel eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München. • Gemälde der Künstlerin befinden sich in bedeutenden öffentlichen Sammlungen, u. a. der Pinakothek der Moderne, München, dem Museum Frieder Burda, Baden-Baden, und der Olbricht Collection, Berlin. Wir danken Frau Prof. Karin Kneffel für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Galerie Schönewald und Beuse, Krefeld (verso auf dem Keilrahmen mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (2004 vom Vorgenannten erworben). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 16.10 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONKarin Kneffel 1957 Marl - lebt und arbeitet in Düsseldorf und München Ohne Titel. 2003. Oil on canvas. Signed and dated on the reverse. 50 x 60 cm (19.6 x 23.6 in). • The photorealistic painting style with moments of irritation is typical of Kneffel. • In a sophisticated optical illusion, the mastiff seems to move out of its own fur pattern. • From the series of works made in the early 2000s, in which dogs in varying poses are the main motif. • Kneffel held a professorship at the Academy of Fine Arts in Munich from 2008 to 2022. • Paintings by the artist can be found in important public collections like the Pinakothek der Moderne, Munich, the Museum Frieder Burda, Baden-Baden, and the Olbricht Collection, Berlin. We are grateful to Prof. Karin Kneffel for her kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Galerie Schönewald und Beuse, Krefeld (gallery label on the reverse). Private collection North Rhine-Westphalia (acquired from the above in 2004). Called up: December 8, 2023 - ca. 16.10 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Der Angler am Waldbach. 1844. Öl auf Holz. Rechts unten mit der Signaturparaphe sowie datiert. 29,8 x 25,8 cm (11,7 x 10,1 in). • Besonders konzentriertes Motiv in der Komposition von Landschaft und Figur. • Aus der Phase der Orientierung an den französischen Zeichnern, vor dem Hintergrund Spitzwegs Mitarbeit an den „Fliegenden Blättern“, 1844 erstmals erschienen. • Eines der wenigen von Spitzweg datierten Werke, von besonderer Wichtigkeit im Oeuvre des Künstlers • Charakteristische humoristische Szene mit unnachahmlicher Spitzwegscher Ironie. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatbesitz Schweiz. Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 281 (m. Abb.). Wohl Verkaufsverzeichnis Nr. 44: 'Fischende (2ter gemalter in Frak.. auf Holz) sh. No. 31, 1844 Jänner, Hannover, 36 Thaler, p. ct. retour, 1845, 14. Mai Straßburg, Gulden 90 Rheinische, 1845 Mannheim verkauft für 90 Gulden.' Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Nachlass Hermann Uhde-Bernays, I.B, Materialsammlung zu Spitzweg, Ordner 'Bilder der Frühzeit' (Abb.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg und die französischen Zeichner, Ausst.-Kat. Haus der Kunst München, 1985, S. 137, Nr. 101 (m. Abb.), S. 426. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Der Angler. Dokumentation, Starnberg-München, R.v.u.a.K. 1995, S. 24f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 76. Dieses Motiv des Anglers entsteht in einer Zeit, in der sich Spitzweg intensiv mit der Karikatur und der spitzen Feder der französischen Zeichner beschäftigt. Der Maler, Grafiker und Verleger Kaspar Braun gründet 1844 in München die illustrierte Zeitschrift „Fliegende Blätter“, für die er auch Spitzweg als Mitwirkenden Zeichner gewinnen kann. Vorbild waren die satirischen Pariser Blätter „Charivari“ und „La Caricature“, in denen Größen wie Paul Gavarni, Gustave Doré oder Honoré Daumier ihre treffenden Karikaturen veröffentlichten. Auch die „Fliegenden Blätter“ werden für ihre zielsichere Charakterisierung des deutschen Bürgertums schnell bekannt. Zwischen Gedichten, Erzählungen und Vermischtem tragen vor allem die Illustrationen solcher Blätter zu einer panorama-artigen Typologie der Gesellschaft bei, bei denen besonders das gesetzte Bürgertum ins Zentrum des Spottes rückt. Aus Figuren der „Fliegenden Blätter“ geht schließlich auch der die Zeitspanne der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnende Begriff des „Biedermeier“ hervor. Gekennzeichnet ist diese Zeit der Restauration bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution von 1848 von einem Rückzug ins Private, in die kleinen Freuden des Alltags und einer Abkehr von politischen oder gesellschaftlichen Turbulenzen. Der Gestaltung des privaten Lebens und der Freizeit wird dagegen immer größere Aufmerksamkeit zuteil. Einen solchen gutsituierten, wohl aus dem städtischen Raum stammenden Bürger hat es hier in die Waldeinsamkeit verschlagen, wo er sich an einem kleinen Bach zum Angeln niedergelassen hat. Die Kleidung mit Frack und Weste, blütenweißer Halsbinde und hohem schwarzen Zylinderhut scheint nicht gerade zweckdienlich, auch die Nickelbrille weist ihn eher als Gelehrten oder Beamten denn als Naturburschen aus. Seine Unerfahrenheit spricht auch aus der instabilen Lage, in die er sich mit der Wahl des abschüssigen Steins am Ufer des Baches gebracht hat. Mit hochgezogenen Augenbrauen erblickt er seinen Fang am Ende der Leine - vermutlich hätte er sich aufgrund der durchgebogenen Angelrute einen dickeren Fisch erhofft. Ein nächstes Unglück scheint sich zudem abzuzeichnen - wie lange mag der rutschige Stein den Angler noch vor einem Tauchgang bewahren? Solche persönlichen Erlebnisse verschmelzen mit der genrehaften und zugleich karikaturesken Typologie, aus der Spitzweg seine berühmten Sonderlingsgestalten herausformt. Diese haben sich ganz ihrer Passion verschrieben und gehen ihr in schönstem Dilettantismus aber mit nicht unerheblichem Eifer nach – im Grunde so wie Spitzweg seiner Malerei. Auch Spitzweg als Münchner Bürger ist wie der Angler viel in den Bergen und auf dem Land unterwegs, als Maler und ebenso ausgestattet mit Nickelbrille dürfte er selbst durchaus als Sonderling wahrgenommen worden sein. Die Vielfalt der Abwandlungen des Angler-Motivs in unterschiedlichen Techniken lassen darauf schließen, dass Spitzweg schon in den frühen 1830er Jahren das Bildthema aufgenommen hatte und aus dem einsamen Sonntagsfischer eine seiner beliebten Sonderlingsfiguren gemacht hatte. Dieser „Angler“ ist darüber hinaus eines der seltenen Werke mit Datierung, die Spitzweg nur in Ausnahmefällen auf Wunsch von Auftraggebern oder wenn ihm ein Gemälde besonders gelungen schien der Signatur hinzufügte. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.30 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Hamlet und der Geist seines Vaters. Um 1870. Öl auf Papier, kaschiert auf Malkarton. Verso mit dem Nachlassstempel sowie verschiedentlich nummeriert und mit Galerieetikett. 29,8 x 37 cm (11,7 x 14,5 in). Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers. Otto Spitzweg (1843-1921), Neffe des Künstlers (bis 1904). Hugo Helbing, München (1905-1907). Sammlung 'Greber', o. O. (wohl Heinrich Greber, München, seit 1907: Hugo Helbing, laut Annotation im Handexemplar des Auktionskataloges). Wohl Besitz Kohler, Luzern (vor 1965). Gemälde-Galerie Abels, Köln (1977, verso mit Etikett). Privatsammlung Baden-Württemberg. AUSSTELLUNG: Begegnungen mit Moritz von Schwind und Arnold Böcklin und die kleine Landschaft, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie, München, 1985, Kat.-Nr. 138 (m. Abb.). LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1288 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 1369 (m. Abb.). Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Nachlass Hermann Uhde-Bernays, I.B, Materialsammlung zu Spitzweg, Ordner ASF 3 (Abb.). Hugo Helbing, München, 20./21.6.1905, Nr. 548 ('Hamlet Szene. Erscheinung des Königs vor den Wächtern', unverkauft, Übernahme von Hugo Helbing). Hugo Helbing, München, 26.6.1907, Nr. 48, m. Abb. (Handexemplar: Bibliothek Kunsthaus Zürich). Galerie Abels, Köln, 1977, S. 2 (m. Abb.). Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.31 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Hamlet und der Geist seines Vaters. Um 1870. Oil on paper, laminated on cardboard. With the estate stamp, several numbers and a gallery label on the reverse. 29.8 x 37 cm (11.7 x 14.5 in). We are grateful to Mr Detlef Rosenberger, who examined the original work, for his kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Artist's estate. Otto Spitzweg (1843-1921), artist's nephew (until 1904). Hugo Helbing, Munich (1905-1907). Collection 'Greber', no place (presumably Heinrich Greber, Munich, since 1907: Hugo Helbing, according to annotations in the working copy of the auction catalog). Presumably Kohler, Lucerne (before 1965). Gemälde-Galerie Abels, Cologne (1977, with the label on the reverse). Private collection Baden-Württemberg. EXHIBITION: Begegnungen mit Moritz von Schwind und Arnold Böcklin und die kleine Landschaft, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie Munich, 1985, cat. no. 138 (fig.). LITERATURE: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, no. 1288 (fig.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, Munich 1960, no. 1369 (fig.). German Art Archive Nuremberg, estate of Hermann Uhde-Bernays, I.B, Spitzweg material, file ASF 3 (fig.). Hugo Helbing, Munich, June 20/21, 1905, no. 548 ('Hamlet Szene. Erscheinung des Königs vor den Wächtern'). Hugo Helbing, Munich, June 26, 1907, no. 48, fig. (Working copy: Library of Kunsthaus Zürich). Galerie Abels, Cologne, 1977, p. 2 (fig.). Called up: December 9, 2023 - ca. 13.31 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Flachlandschaft im Vorgebirge. Um 1870. Öl auf Holz. Links unten mit der Signaturparaphe. Verso mit altem, typografisch nummeriertem Etikett '84'. 12,1 x 32,4 cm (4,7 x 12,7 in). Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. Wir danken Samuel Reller, Kunstmuseum Sankt Gallen, für die Hinweise zur Provenienz. PROVENIENZ: Kunsthandlung Julius Eymer, Wien (bis 1919: Helbing, 21.11.1919). Sammlung Eduard Sturzenegger (1854-1932), St. Gallen (1919 vom Vorgenannten erworben, bis 1926). Schenkung Eduard Sturzenegger, 1926 (Nr. 126, „Sommertag'). Sturzeneggersche Gemäldesammlung, Stadt St. Gallen (1926-1935/36). Ludwigsgalerie, München (in Kommission aus dem Eigentum der Vorgenannten, verkauft zwischen 4.11.1935 und 9.12.1936). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1222 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 185 (m. Abb.). Hugo Helbing, München, Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Privatbesitz, Auktion 18.11.1919, verschoben auf 21.11.1919, Nr. 269 (m. Abb. Taf. 15). Versteigerungshaus Weiner, München, 14.12.1983, S. 78, Nr. 221. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Das gestreckte Format. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1996, S. 14f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 113. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ein Sommertag in Franken, Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 2000, S. 34f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 155. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.32 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Flachlandschaft im Vorgebirge. Um 1870. Oil on panel. Lower left with the signature paraph. With an old typographically numbered label '84' on the reverse. 12.1 x 32.4 cm (4.7 x 12.7 in). We are grateful to Mr Detlef Rosenberger, who saw the original work, for his kind support in cataloging this lot. We are also grateful to Samuel Reller, Kunstmuseum Sankt Gallen, for his help with the provenenace. PROVENANCE: Art dealer Julius Eymer, Vienna (until 1919: Helbing, November 21, 1919). Eduard Sturzenegger Collection (1854-1932), St. Gallen (acquired from the above in 1919, until 1926). Donation Eduard Sturzenegger, 1926 (no. 126, 'Sommertag'). Sturzeneggersche Gemäldesammlung, Stadt St. Gallen (1926-1935/36). Ludwigsgalerie, München (on consigment from the above, sold between November 4, 1935 and December 9, 1936). Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, no. 1222 (fig.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, Munich 1960, no. 185 (fig.). Hugo Helbing, Munich, Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Privatbesitz, auction on November 18, 1919, postponed to November 21, 1919, no. 269 (fig. plate 15). Versteigerungshaus Weiner, Munich, December 14, 1983, p. 78, no. 221. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Das gestreckte Format. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1996, pp. 14f., Bavarian State Library Munich, inv. no. Ana 656 SW 113. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ein Sommertag in Franken, Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 2000, pp. 34f., Bavarian State Library Munich, inv. no. Ana 656 SW 155. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.32 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Der Postbote. Um 1860. Öl auf Holz. Links unten mit der Signaturparaphe. 27,2 x 20,8 cm (10,7 x 8,1 in). • Romantisches Motiv: Briefe und heimliche Botschaften sind von zentraler Bedeutung in Spitzwegs Œuvre, selbst unaufhörlicher Briefeschreiber und Postreisender • Inszenatorisch raffinierte, erzählerische Komposition durch die malerischen und bedeutungsvollen Details • Spitzwegs Bildwelten zeigen seine Meisterschaft in Architekturdarstellung und Raumwirkung • Besondere Version aus der Reihe der Postboten mit Ausblick in Spitzwegs geliebtes Himmelblau. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatsammlung (seit 1926 in Familienbesitz). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Sotheby's, London, 19th Century European Paintings, including German, Austrian and Central European Paintings, and The Scandinavian Sale, 31.6.2006, Los 31 (m. Abb.). Im Skizzenbuch von 1858 formuliert Spitzweg gedanklich die Bilderzählung, die er anschließend in unterschiedlichen Versionen ausführt: „Einfahrt eines Postwagens in ein kleines Städtchen … lauter Mädels die nur aus den Fenstern schauen oder anders …“ (zit. n. Wichmann 2002, S. 269). Von der Figur des Postbotens, mit Paket unterm Arm und dem Brief in der erhobenen Hand skizziert er in großer Detailfreude und bereits im Hinblick auf die Verwendung in Gemälden als Rückenansicht, vor der man sich die Szene mit den erwartungsfrohen Empfängerinnen bereits vorstellen kann. Nach einem Vermerk in einem um 1860 geschriebenen Brief bereitet er von diesem Thema auch mehrere Skizzen vor. Die Szene arrangiert er in unterschiedlichen Variationen mit den wesentlichen Elementen: im Vordergrund der junge Bote in der blau leuchtenden modischen Uniform, der den Brief zur Übergabe bereit hält. Die Mädchen und Damen stehen bereits an den Fenstern und Türen, neugierig und voller Vorfreude erhofft sich die ein oder andere vielleicht einen neuen Sommerhut, den das runde, an eine Hutschachtel erinnernde Paket verheißt, oder einen Gruß aus der Hand des Geliebten. Welche mag wohl die Auserwählte des Postboten sein, der die Aufmerksamkeit sicherlich auch zu genießen weiß? Die Hutschachtel könnte dabei an die beiden sich von links der Treppe annähernden feinen Damen gehen, der Liebesbrief vermutlich an die junge Frau in dem mit Rosen und Turteltäubchen versehenen Erker. Nicht ohne Ironie verpasst Spitzweg in dieser Version dem Postboten eine Krücke, vielleicht auf eine frühere Kriegsverwundung hinweisend, oder als Seitenhieb auf die Langsamkeit der Postzustellung. Wie auf einer Bühne arrangiert Spitzweg die Szene in dem kleinen Städtchen. Auch hier ist der zentrale Ort des Geschehens ein kleiner Platz mit Brunnen, von dem aus der Blick in die enge Gasse in die Tiefe führt, dahinter hellblau leuchtenden der typisch Spitzweg’sche Sommerhimmel. Den kleinen Bildraum verschachtelt Spitzweg kunstvoll mit den in- und aneinandergebauten Häusern. Die Landflucht hatte zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Menschen in die Städte gebracht und so wohnen sie nun wohlgeschichtet übereinander mit engen Türen, aufgestockten Fenstern, Balustraden und Erkern eng beisammen. Fenster-Ein- und Ausblicke bereichern das alltägliche enge Miteinander, auch Spitzweg beobachtet aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung hinaus das reiche Unterhaltungsrepertoire. Der in den Sommermonaten dauerhaft auf Reisen umherschweifende Spitzweg führt zeichnerisch Buch über seine Entdeckungen und zeichnet im süddeutschen und Tiroler-Raum in Memmingen, Bad Tölz, Augsburg, Innsbruck und Bozen. Oftmals positioniert er sich dabei auf dem Marktplatz, dem Zentrum der Städtchen vor Kirche oder Rathaus, auf dem die Bewohner zusammentreffen. Das Gewirr der Fassaden, Giebel, Treppen und Fenster einer über Jahrhunderte einigermaßen willkürlich und ungeplant zusammengewachsenen Architektur scheint ihn dabei künstlerisch besonders zu interessieren. In den Architekturen seiner Werke verschmelzen ebenso die verschiedensten Stile und Epochen, mittelalterliche niedrige Häuschen, aus denen Schornsteine, Dachgauben und Torbogen wachsen, ducken sich neben wuchtigen barocken Türmen und geschwungenen Giebeln. Hieraus ergeben sich helle und dunkle Winkel, Schattenwürfe und hell erleuchtete Partien, die den Gebäuden ihre Lebendigkeit verleihen. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.34 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Das Ständchen. Um 1875. Öl auf Holz. Verso mit dem handschriftlichen Besitzervermerk 'G G Elberfeld'. 20,5 x 13 cm (8 x 5,1 in). • Ikonisches musikalisches Motiv für die Malerei der Romantik und des Biedermeier • Spitzweg ist inspiriert von Theater und Oper, der Beginn des 'Barbier von Sevilla' von Rossini regt seine malerische Fantasie zu einer Reihe von nächtlichen Ständchen an • Besonders atmosphärische, in der Lichtregie dramaturgisch raffinierte Version des Ständchens. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatsammlung Hamburg (bis 1904: Lepke). Eduard Schulte, Berlin (wohl vom Vorgenannten erworben). Galerie Heinemann München (1904 vom Vorgenannten erworben). Kommerzienrat Carl August Jung (1842-1911), Elberfeld (1905 vom Vorgenannten erworben). Privatsammlung Baden-Württemberg. AUSSTELLUNG: Deutsche Jahrhundertausstellung, Nationalgalerie Berlin, 1906, Nr. 1697 (m. Abb. Bd. 2, S. 528). Gedächtnis-Ausstellung, Kunstverein München, Juni 1908, Nr. 58. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1555 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 1072 (m. Abb.). Rudolf Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin, Auktion 13.12.1904, Los 126 (m. Abb. Taf. 2: 'Altertümliche Straße bei Mondbeleuchtung'). Hyazinth Holland, Karl Spitzweg, München 1916, S. 22, Nr. 28 (m. Abb.). Max von Boehn, Carl Spitzweg, 4. Aufl., Bielefeld/Leipzig 1937, S. 26 (m. Abb.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ständchen-, Serenaden- und Straßensänger-Bilder. Ein Beitrag zum musikalischen Spitzweg, Starnberg-München 1975, Nr. 24 (m. Abb. 24). Sotheby's München, Auktion 18.5.1988, Los 31 (m. Abb.). ARCHIVALIEN: Galerie Heinemann, München, Kartei verkaufte Bilder, Heinemann-Nr. 7384 (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Kartei Dokument-ID: 10637, über https://heinemann.gnm.de/). Galerie Heinemann, München, Käuferkartei „Jung“ (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Kartei Dokument-ID: 16970, über https://heinemann.gnm.de/). Galerie Heinemann, München, Lagerbuch gehandelte Werke (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, LB-04-21, Blatt: 19, Dokument-ID: 20892, über https://heinemann.gnm.de/). Nachlass Hermann Uhde-Bernays, Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, IB, Materialsammlung zu Spitzweg, ASF1 Fotokartei, Abb. mit handschriftlichem Vermerk: „Elberfeld (Kom. R. C. A Jung)“. Mit seinem herausragenden erzählerischen Vermögen gelingt es Spitzweg, mit den Erwartungen der Betrachtenden zu spielen. So auch in unserem Ständchen: In der verwinkelten Heimlichtuerei der verschatteten und vom Mondschein spärlich beleuchteten Architektur, verstellt von Mauern und Erkern, hat sich der verliebte Musikant, ein junger Student vielleicht, auf den Dorfplatz mit dem leise plätscherndem Brunnen gestellt. Dort angekommen muss er feststellen, dass ihm wohl bereits ein anderer Verehrer bei seiner Angebeteten zuvorgekommen ist, wie schemenhaft in dem erleuchteten Fenster zu erkennen. Die Betrachtenden sehen dem Dupierten dabei zu, wie er seine eigene Enttäuschung verarbeiten muss. Mit Humor gelingt es jedoch, diese Desillusionierung zwischen Ideal und Wirklichkeit der schwärmerischen Gestalten der Romantik und des Biedermeier im Leben zu ertragen und ihr sogar noch etwas positives abzugewinnen. Schon früh taucht das Motiv des verliebten Musikanten in Form des Dachgeigers im Werk Spitzwegs auf, zunächst noch mit Ähnlichkeiten zur Physiognomie des Künstlers selbst, und beschäftigt ihn bis in die 1870er Jahre mit zahlreichen fantasievollen Abwandlungen und Zuspitzungen. 1848 notiert er in sein Tagebuch die Beobachtung einer solchen Szene: “nächtlicher Geiger gesehen – wie einst! – Lange Schatten – Lichtpunkte auf der Mauer“ (Wichmann 2002, S. 180). Zeitweise wohnt Spitzweg selbst über den Dächern Münchens und mag vielleicht einiger solcher musikalischen Annäherungsversuche miterlebt haben. Darüber hinaus treffen diese auf das Interesse Spitzwegs an Musik und Theater. Eine bekannteste Abwandlung des Motivs ist die Version des 'Spanischen Ständchens' von 1856 (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Schack, München), in dem Spitzweg wohl die Anfangsszene der Oper 'Der Barbier von Sevilla' wiedergibt - dort erscheint der Graf Almaviva mit einer Gruppe Musikanten unter dem Balkon seiner Angebeteten Rosina. Der von Theater und Oper und ihren Szenen beeindruckte Spitzweg macht sich in seinen Gemälden deren inszenatorische und dramatische Prinzipien zu eigen. Spitzwegs angeheiratete Neffen sind Mitglieder und bedeutende Solisten der bayerischen Hofkapelle, geleitet von seinem Onkel Joseph Moralt, die im Orchester bei einer Aufführung genau dieser Oper mitwirken. Das Ständchen darf als ein beliebtes und persönliches Motiv Spitzwegs gelten, das hier in den für seine Nachtstücke so charakteristischen silbrigen Blautönen mondbeschienener Städtchen unter dem Sternenhimmel wiedergegeben wird. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.35 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Institutsspaziergang. Um 1866-1870. Öl auf Leinwand. Links unten mit der Signaturparaphe. Verso auf der Leinwand mit schwer leserlichem Stempel, evtl. Malereibedarf. Verso auf dem Keilrahmen nummeriert, mit Etikett mit Besitzervermerk und nummeriertem Etikett. 32,3 x 53,5 cm (12,7 x 21 in). • Eine zweite Version des Motivs befindet sich in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek München • Auf einzigartige Weise zeigen sich hier Spitzwegs kompositorische Qualitäten in der Kombination von atmosphärischer Landschafts- mit anekdotischer Figurendarstellung • Eine der erzählerisch gelungensten und variationsreichsten Szenen in weitem Landschaftspanorama • Zauberhafter, sommerlicher Farbklang in den für Spitzwegs Landschaften so besonderen hellen, warmen Gelb- und Blautönen. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatbesitz, Darmstadt (seit 1934). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 955 (mit leicht abweichenden Maßangaben). Vgl. Carl Spitzweg, Handschriftl. Verkaufsverzeichnis, in: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Kunst, Kosten und Konflikte, S. 341f., Nr. 396: '4 Landschaft Kloster Institutsfräul. / spazierend Carton 80 17 Juni verkauft an H.L.Schmederer in der AU Bräuereibesitzer erhalten d. 19 Juni 1880' Hermann Uhde-Bernays, Des Meisters Leben und Werk, 10. Auflage, München 1935, Nr. 122 (m. Abb.). Vgl. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1169, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München. Meisterhaft gelingt es Spitzweg in seinen Werken, verschiedene Gattungen wie hier die Landschaft und das belebte genrehafte Vielfigurenbild zu vereinen. Vor einer bis in die Tiefe detailliert wiedergegebenen Szenerie erwandert sich eine kleine Gruppe Klosterschülerinnen unter der Aufsicht besorgter Schwestern die sommerliche Landschaft. Ausgestattet mit Sonnenschirmchen, Sonnenhüten und kleinen Proviantkörbchen ist so trotz der züchtigen dunklen Schulumhänge eine beschwingte Stimmung zu verspüren. Die links und rechts vom Wegesrand verteilten Figurengrüppchen lassen erraten, wie schwer es sein mag, die neugierigen und aufgeweckten Mädchen buchstäblich und im metaphorischen Sinne auf dem rechten Weg zu halten. Linkerhand hält eine Bauernfamilie unter einem schattigen Gebüsch Rast, die gelb leuchtenden Blumen laden zum Pflücken ein. Auf der rechten Seite ist ein Liebespaar mit Husar und Mädchen auf dem Weg zu einem lauschigen Bänkchen, um sich dort für ein Schäferstündchen niederzulassen. Müßiggang und Liebesabenteuer werden jedoch kaum auf dem Unterrichtsplan der Nonnen stehen. Die Landschaftsmalerei prägt die Anfänge Spitzwegs, mit seinem Malerfreund Eduard Schleich führen ihn etliche Wanderungen in die bayerischen Alpen. Zeit seines Lebens beschäftigt sich Spitzweg mit der Natur und den unterschiedlichen Landstrichen, die er in den Sommermonaten zu Fuß oder mit der Postkutsche erschließt. Mit der Zeit finden Figuren in seine Landschaftsansichten hinein, die Szenerie im vorliegenden Bild nimmt eine Ansicht von Dinkelsbühl in Franken als Kulisse (Wichmann-Nr. 1168). Es sind dabei oft dem akademischen Kanon nicht entsprechende Landschaftsmotive, die Spitzwegs Interesse wecken, sondern selbst auf Reisen eingefangene regionale Eindrücke. Sie bezeugen die Kenntnis der Gemälde der vorimpressionistischen Schule von Barbizon und ihrer „paysage intime“, die Spitzweg auf seiner Parisreise 1851 kennengelernt haben dürfte. Besonders die Lebendigkeit und Ungekünsteltheit seiner Landschaften fasziniert nicht zuletzt durch die Wiedergabe von Licht und Schatten, Wetter und Atmosphäre der zumeist im Sommer entstandenen Motive. Die Weite des Raums kommt auf dem für ihn so typischen langgezogenen Format zur Geltung, das er geschickt von den Figuren im Vordergrund bis in den Himmel mit den hoch fliegenden kleinen Schwalben harmonisch mit Leben füllt. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.36 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Jäger mit Mädchen (Der verliebte Jäger). Um 1848-1852. Öl auf Leinwand. Links unten mit der Signaturparaphe. 33,7 x 24,9 cm (13,2 x 9,8 in). • Wohl eine der frühesten Fassungen des Motivs 'Jäger und Mädchen' im Werk Spitzwegs • Effektvoll inszenierte Szene des ländlichen Liebespaars vor der Kulisse des gebirgigen Hochwalds • Fein und detailreich ausgearbeitete Komposition, die die beiden wildromantischen Charaktere als größere Einzelfiguren besonders in den Blick rückt. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatsammlung Berlin. Privatsammlung Baden-Württemberg. AUSSTELLUNG: Carl Spitzweg: Reisen und Wandern in Europa und der glückliche Winkel, Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon, 22.9.2002-5.1.2003; Haus der Kunst, München, 24.1.-4.5.2003, S. 152f., Kat.-Nr. 69 (m. Abb.). LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1483 (m. Abb.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Jäger mit Mädchen im Wald. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1984, S. 12-19, 24-27, Bayerische Staatsbibliothek, München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 19. Das verliebte Paar in der alpenländischen Natur, mit den Figuren des Jägers und der Sennerin stellt eines der schönsten wiederkehrenden Motive in Spitzwegs Œuvre dar. Während seiner zahlreichen Wanderungen im Alpenvorland, den Münchner Hausbergen und Tirol dürfte er diesen beiden als Symbolfiguren idyllischer, freier Ländlichkeit des Öfteren begegnet sein. In seinen Skizzenbüchern finden sich etliche Zeichnungen des Paares, deren Zuneigung er in immer neuen Posen arrangiert. Bereits seit seiner Frühzeit variiert Spitzweg das Thema in kleinen Details und Nuancen: mal findet ein Treffen in der Felsenschlucht statt, mal auf einem Gebirgspfad am kleinen Marterl, im Hochwald oder am Brunnen. Die künstlerische Subtilität Spitzwegs zeigt sich in dem unterschiedlichen Charakter der Begegnungen, die als zufälliges Aufeinandertreffen erfolgen, als Stelldichein in nächtlicher Heimlichkeit oder auch tagsüber bei der mittäglichen Rast, wie die Chronik einer Liebesgeschichte in den Alpen, wenn man alles zusammennähme. Die beiden Figuren und ihre Romanze scheinen ihn nicht nur malerisch nachhaltig beschäftigt zu haben, merkt man doch an den zahlreichen Varianten die theatralische Lust am inszenieren und an der Erzählung. Bei einigen der Gemälde steht die Landschaft im Vordergrund, bei anderen - so wie in diesem Fall - treten die Figuren größer im Vordergrund auf. Sie wenden sich, ganz ineinander vertieft, vom Betrachter ab und spazieren in den dichten Wald, hinter dem man - in ganz Spitzwegscher Manier - einen kleinen Ausblick erhaschen darf auf den hinter den Wolken silbrig schimmernden Mond. Deutlicher als andere Variationen des Themas verortet er die Szene hier im Gebirge, wie es sich in der am rechten Rand eingefügten Felswand zeigt. Außergewöhnlich ist im vorliegenden Gemälde auch die Lichtregie, die wie vor einer Waldbühne von vorne zusätzlich beleuchtet zu sein scheint. Neben die in tupfenhafter und lockerer Malweise in den unterschiedlichsten Grüntönen wiedergegebenen Vegetation und dem Anzug des Jägers setzt Spitzweg im Gewand der Sennerin seinen bevorzugten Farbklang aus rotem Rock, blauer Schürze, schwarzem Mieder und weißer Bluse, zurückhaltend hier jedoch in kleinster und subtiler Dosierung. Die beiden Figuren des Jägers und der Sennerin finden sich auch in einzelfigurigen Szenen in Spitzwegs Œuvre, hier finden sie auf heimlich-romantische Art im Gemälde zusammen. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.38 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Jäger mit Mädchen (Der verliebte Jäger). Um 1848-1852. Oil on canvas. Lower left with the signature paraph. 33.7 x 24.9 cm (13.2 x 9.8 in). • Probably one of the earliest versions of the 'Hunter and Girl' motif in Spitzweg's work • Effectively staged scene of the rural love couple against the backdrop of the mountain forest • Finely crafted composition, rich in detail, which focuses on the two romantic characters as larger individual figures. We are grateful to Mr Detlef Rosenberger, who examined the original work, for his kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Private collection Berlin. Private collection Baden-Württemberg. EXHIBITION: Carl Spitzweg: Reisen und Wandern in Europa und der glückliche Winkel. Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon September 22, 2002 - January 5, 2003; Haus der Kunst, Munich, January 24 - May 4, 2003, pp. 152-153, cat. no. 69 (fig.). LITERATURE: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, no. 1483 (fig.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Jäger mit Mädchen im Wald. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1984, pp. 12-19, 24-27, Bayerische Staatsbibliothek, München, inv. no. Ana 656 SW 19. The love couple in the Alpine countryside, with the figures of the hunter and the dairymaid, is one of the most beautiful recurring motifs in Spitzweg's oeuvre. During his numerous hikes in the foothills of the Alps, Munich's local mountains and Tyrol, he was likely to frequently encounter these two as symbolic figures of an idyllic rural life. His sketchbooks contain numerous drawings of the couple, arranging their affection in ever new poses. Even from his early days, Spitzweg varied the theme in small details and nuances: sometimes a meeting takes place in a rocky gorge, sometimes on a mountain path at a small shrine, in a mountain forest or at a fountain. Spitzweg's artistic subtlety becomes evident in the encounters’ varying characters. A chance meeting, a rendezvous at night in secrecy or during the day at a midday rest, like the chronicle of a love story in the Alps. The two figures and their romance seem to have been a lasting preoccupation for him, and not just in terms of painting, as the numerous variations thereof testify to his joy in staging and telling the story. In some of the paintings, the landscape is in the foreground, in others - as in this case - the figures appear larger in the foreground. They turn away from the viewer, completely immersed in each other, and walk into the dense forest, behind which - in true Spitzwegian style - we catch a glimpse of the moon shimmering silvery behind the clouds. More clearly than inother variations on the theme, he located the scene in the present work in the mountains, as the rock face in right suggests. The lighting is also unusual in this painting, which appears to be lit from the front, as if in front of a forest stage. Alongside the vegetation and the hunter's suit, depicted in a dabbed and loose painting style in various shades of green, Spitzweg uses his preferred color scheme of red skirt, blue apron, black corsage and white blouse as the dairymaid's apparel, albeit in the smallest and most subtle doses. The two figures of hunter and dairymaid can also be found individually in single-figure scenes in Spitzweg's oeuvre; in this painting they come together in a secretly romantic way. [KT] Called up: December 9, 2023 - ca. 13.38 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Wundervögel. 1917. Öl auf Leinwand. Rechts unten monogrammiert und datiert. Verso auf dem Keilrahmen handschriftlich und typografisch nummeriert. 80,5 x 95,5 cm (31,6 x 37,5 in). PROVENIENZ: Paul und Beth von Bleichert, Leipzig (wohl 1917 erworben). Paul und Beth von Bleichert, Zürich (1920er Jahre, bis 2014 in Familienbesitz). Jack Kilgore & Co. Gallery, New York. Daxer & Marschall, München. Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Vgl. Henry Thode, Hans Thoma, Stuttgart/Leipzig 1909, S. 355, 421. Joseph August Beringer, Der Malerpoet, München 1917, o.S., Abb. Taf. 17. Die menschliche Sehnsucht, die erdhafte Gebundenheit im schwerelosen Flug zu überwinden, hat Hans Thoma vor allem in den Gemälden seiner sogenannten „Wundervögel“ zum Ausdruck gebracht. Bereits 1876 taucht im Gemälde „Paradies“ (Thode S. 89) ein solcher fantastischer Vogel auf. Ein weiteres Gemälde mit dem Titel „Sehnsucht“ (Thode S. 427) von 1900 zeigt einen Jüngling in einer weiten Flusslandschaft, der den am Himmel ziehenden Vögeln nachblickt. Besonders faszinieren allerdings die Gemälde, in denen die Betrachtenden gewissermaßen mit den Vögeln fliegen, weit über der sanften Landschaft in einem von irrealem, hellen Licht durchdrungenen Raum. Thoma vereint in ihnen die aus der ostasiatischen Kunst zu der Zeit bekannten Kraniche mit den weiten Schwingen mit den langen Feder des Paradiesvogels, teilweise auch der Pfauen. Das Motiv der Vögel führt er auch in der grafischen Technik der Radierung aus und gestaltet sich selbst damit ein Exlibris, in denen die Ornamentalität der Vogelgestalten besonders zur Geltung kommt. Den Vogelbildern scheint er auch einigen persönlichen Charakter beizumessen und als Freundschaftsbilder zu fungieren, widmet er doch seinem Freund Philipp Röth zum 60. Geburtstag solch eine Zeichnung und auch Henry Thode ist im Besitz eines der Gemälde. Der Wundervogel steht aber auch für das Reich der Fantasie und der Kunst, die sich nicht der Realität verpflichtet fühlt. In unterschiedlichen Flughaltungen schweben die großen Tiere mit den geschwungenen Hälsen und Federn über den Himmel, riesig über Landschaft, und erlauben den Betrachtenden eine neue Perspektive. Das traumhafte Gefühl des Schwebens hat für Thoma essentielle Bedeutung: „In meinen Bildern und ihrem Raum soll man Fliegen können“ (J.A. Beringer, Vollständiges Verzeichnis der radierten Platten und ihrer Zustände, München 1923, S. XIV). Der Kunsthistoriker Joseph August Beringer wies auch darauf hin, dass das Phänomen des Fliegens gerade in der Zeit der beginnenden Luftfahrttechnik einen besonderen Reiz auf Thoma ausgeübt haben könnte. Greifbar wird das Gefühl der Irrealität, das in so vielen von Thomas Bildern spürbar ist. Das Schweben im Raum, das Gefühl der Freiheit und die Sehnsucht nach ihr werden von Thoma in Gestalt der Wundervögel immer wieder thematisiert. In den geschwungenen Linien der Tiere lassen sich zudem Anklänge an die Kunst des Jugendstils sowie japanische Holzschnitte erkennen, wie sie um die Jahrhundertwende Konjunktur hatten. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.42 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Wundervögel. 1917. Oil on canvas. Lower right monogrammed and dated. With written and typogr. numbers on the reverse of the stretcher. 80.5 x 95.5 cm (31.6 x 37.5 in). PROVENANCE: Paul und Beth von Bleichert, Leipzig (presumably acquired in 1917). Paul und Beth von Bleichert, Zürich (1920s, family-owned until 2014). Jack Kilgore & Co. Gallery, New York. Daxer & Marschall, Munich. Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Cf. Henry Thode, Hans Thoma, Stuttgart/Leipzig 1909, pp. 355, 421. Joseph August Beringer, Der Malerpoet, Munich 1917, no p., fig. plate 17. Hans Thoma expressed the human longing to overcome gravity in weightless flight in paintings of his so-called 'miracle birds'. Such a fantastic bird appeared for the first time in the painting 'Paradise' from 1876 (Thode p. 89). Another painting entitled 'Sehnsucht' (Thode p. 427) from 1900 shows a young man in a wide river landscape gazing at migrating birds in the sky. Particularly fascinating, however, are the paintings in which the viewer flies with the birds, as it were, far above the gentle landscape in a space permeated by unreal, bright light. In them, Thoma combines the wide-winged cranes familiar from East Asian art with the long feathers of the bird of paradise, and in some cases peacocks. He also made etchings of the motif he then used as his own bookplate, in which he particularly emphasized the ornamentality of the birds. He also seems to have attached a personal character to the bird pictures, as he dedicated such a drawing to his friend Philipp Röth for his 60th birthday and Henry Thode also owned one of the paintings. However, the miracle bird also stands for the realm of fantasy and art that does not feel bound to reality. In various flying postures, the large animals with their curved necks and feathers float above the landscape, allowing the viewer a new perspective. The dreamlike feeling of floating is of essential importance to Thoma: 'In my pictures and their space, one should be able to fly' (J.A. Beringer, Vollständiges Verzeichnis der radierten Platten und ihrer Zustände, Munich 1923, p. XIV). The art historian Joseph August Beringer also pointed out that the phenomenon of flying could have exerted a particular attraction on Thoma, especially at the time when aviation technology was just beginning. The unreal feeling is palpable in so many of Thoma's paintings. Floating in space, the feeling of freedom and the longing for it were repeatedly addressed by Thoma in the form of the miracle birds. The curved lines of the animals are also reminiscent of Art Nouveau and Japanese woodcuts, which were popular at the turn of the century. [KT] Called up: December 9, 2023 - ca. 13.42 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Die Brücke (Sommerabend). 1892. Öl auf Holz. Rechts unten monogrammiert (in Ligatur) und datiert. Verso in gelber Kreide unleserlich nummeriert und bezeichnet sowie mit nummeriertem Etikett '990' und altem, fragmentiertem Etikett. 33,3 x 41,3 cm (13,1 x 16,2 in). PROVENIENZ: Fritz Gurlitt, Berlin (1909). Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt. Privatsammlung Deutschland. Privatsammlung Schweiz. Privatsammlung Baden-Württemberg (2010 erworben). LITERATUR: Henry Thode, Hans Thoma, Stuttgart/Leipzig 1909, S. 359 (m. Abb.). Joseph August Beringer, Der Malerpoet, München 1917, o.S., Abb. Taf. 10: 'Sommerabend'. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.44 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Die Brücke (Sommerabend). 1892. Oil on panel. Lower right monogrammed (in ligature) and dated. Illegibly numbered in yellow chalks amd inscribed as well as with a numbered label '990' and an old, fragmentarily preserved label on the reverse. 33.3 x 41.3 cm (13.1 x 16.2 in). PROVENANCE: Fritz Gurlitt, Berlin (1909). Collection Georg Schäfer, Schweinfurt. Private collection Germany. Private collection Switzerland. Private collection Baden-Württemberg (acquired in 2010). LITERATURE: Henry Thode, Hans Thoma, Stuttgart/Leipzig 1909, p. 359 (fig.). Joseph August Beringer, Der Malerpoet, Munich 1917, no p., fig. plate 10: 'Sommerabend'. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.44 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Schimmel und Sitzende. 1891. Aquarell und Tusche. Rechts unten monogrammiert (in Ligatur) und datiert. Auf festem Velin. 26,9 x 36,8 cm (10,5 x 14,4 in), blattgroß. PROVENIENZ: Leo Smoschewer (1875-1938), Breslau. Else Smoschewer (vom Vorgenannten durch Erbschaft erworben, bis 1939). Beschlagnahmt durch die Nationalsozialisten 1939. Kunsthandel Wenzel, Breslau (um 1940). Privatsammlung Deutschland. Restitution an die Erben nach Leo und Else Smoschewer 2021. Privatsammlung Baden-Württemberg (Sotheby's, 7.7.-13.7.2022). Das Werk ist frei von Restitutionsansprüchen. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.47 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHans Thoma 1839 Bernau - 1924 Karlsruhe Schimmel und Sitzende. 1891. Watercolor and India ink. Lower right monogrammed (in ligature) and dated. On firm wove paper. 26.9 x 36.8 cm (10.5 x 14.4 in), the full sheet. PROVENANCE: Leo Smoschewer (1875-1938), Wroclaw. Else Smoschewer (inherited from the above, until 1939). Nazi plunder, 1939. Art dealer Wenzel, Wroclaw (around 1940). Private collection Germany. Returned to the heirs after Leo and Else Smoschewer 2021. Private collection Baden-Württemberg (Sotheby's, July 7 - 13, 2022). The work is free from restitution claims. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.47 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Heinrich von Zügel 1850 Murrhardt - 1941 München Schwarz- und Gelbschecke an der Jungviehweide. 1918. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert. 50,5 x 70,5 cm (19,8 x 27,7 in). PROVENIENZ: Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Eugen Diem, Heinrich von Zügel. Leben - Schaffen - Werk, Recklinghausen 1975, WVZ-Nr. 902 (m. Abb.). Um 1894 beginnt Zügel, das 'Malerparadies' um das kleine am Altrhein gelegene Fischerdorf Wörth in der Nähe von Karlsruhe für sich zu entdecken, wo er in seiner mehr als 20-jährigen Lehrtätigkeit an der Karlsruher und Münchner Kunstakademie mit seinen Studenten, der sogenannten Zügelschule, in den Sommermonaten zahlreiche impressionistisch gemalte Landschaften und Tierbilder schafft. Nach 1900 hat sich Zügel vollends der Plein-air-Malerei zugewandt, woraufhin seine Werke zusehends an Schwung und Dynamik gewinnen. Dabei weicht Zügel von der noch zu Beginn seines Schaffens realistisch-beschreibenden Malweise ab und zeigt eine erstaunliche malerische Freiheit, die sich in den breiten, mit Pinsel und Malmesser aufgetragenen pastosen Farbstrichen, aufgelockert durch große und kleinere Tupfen, ausdrückt. Sein eigentliches Interesse als bedeutender Vertreter der Tiermalerei gilt weniger einer präzisen Wiedergabe der Tieranatomie und der Formen als vielmehr dem bewegten und lebendigen Licht in der Natur, das so das Bildgeschehen bestimmt. Zügels späte Werke zeigen einen Künstler, der bis in seine letzte Schaffensphase einer auf impressionistischer Lockerheit basierenden Unmittelbarkeit treu bleibt, die ganz aus der kraftvollen Farbigkeit heraus lebt. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.50 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHeinrich von Zügel 1850 Murrhardt - 1941 München Schwarz- und Gelbschecke an der Jungviehweide. 1918. Oil on canvas. Signed in lower right. 50.5 x 70.5 cm (19.8 x 27.7 in). PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Eugen Diem, Heinrich von Zügel. Leben - Schaffen - Werk, Recklinghausen 1975, catalogue raisonné no. 902 (illu.). Around 1894, Zügel began to discover the 'painter's paradise' around the small fishing village of Wörth on the Old Rhine near Karlsruhe, where he created numerous Impressionist landscapes and animal paintings with his students, the so-called Zügel School, during the summer months of his more than 20-year teaching career at the Karlsruhe and Munich art academies. After 1900, Zügel turned his full attention to plein-air painting, whereupon his works visibly gained momentum and dynamism. Zügel departed from the realistically descriptive painting style he had used at the beginning of his career and showed an astonishing painterly freedom, which was expressed in the broad, impasto strokes of paint applied with brush and pallet knife, broken up by large and small dabs. As an important animal painter, his real interest was less in the precise reproduction of animal anatomy and forms than in the moving and lively light in nature, which thus determines the pictorial events. Zügel's late works show an artist who remained true to an immediacy based on impressionistic looseness, which lives entirely from the powerful colors, right up to his last creative phase. [KT] Called up: December 9, 2023 - ca. 13.50 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Victor Paul Mohn 1842 Meißen - 1911 Berlin Campagnalandschaft. Um 1866-1869. Öl auf Malpappe. Verso mit dem Nachlassstempel sowie nummeriert '86'. 22 x 31 cm (8,6 x 12,2 in). PROVENIENZ: Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.54 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONVictor Paul Mohn 1842 Meißen - 1911 Berlin Campagnalandschaft. Um 1866-1869. Oil on cardboard. With the estate stamp and numbered '86' on the reverse. 22 x 31 cm (8.6 x 12.2 in). PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.54 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Victor Paul Mohn 1842 Meißen - 1911 Berlin Kastanienwald vor dem Monte Serone, Olevano. 1866. Aquarell über Bleistift und Feder. Links unten bezeichnet 'der Serrone vom Kastanienwald Olevano' sowie datiert und signiert. 23,4 x 35,8 cm (9,2 x 14 in), Blattgröße. PROVENIENZ: Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.55 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONVictor Paul Mohn 1842 Meißen - 1911 Berlin Kastanienwald vor dem Monte Serone, Olevano. 1866. Watercolor over pencil and pen. Lower left inscribed 'der Serrone vom Kastanienwald Olevano', as well as dated and signed. 23.4 x 35.8 cm (9.2 x 14 in), size of sheet. PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.55 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hermann Pleuer 1863 Schwäbisch Gmünd - 1911 Stuttgart Vor den Einfahrtshallen des Alten Stuttgarter Bahnhofs. 1909. Öl auf Leinwand. Links unten signiert und datiert. Verso auf dem Keilrahmen mit diversen Etiketten. 80 x 100 cm (31,4 x 39,3 in). PROVENIENZ: Dr. Theodor Sproesser, Stuttgart (1913; verso mit dem Etikett). Kunsthaus Bühler, Stuttgart (verso mit dem Etikett). Privatbesitz Baden-Württemberg (seit mind. 1974). AUSSTELLUNG: Hermann Pleuer 1863-1911. Bilder aus dem Magazin, Galerie der Stadt Stuttgart, 1.3.-22.3.1983. Der deutsche Impressionismus, Kunsthalle Bielefeld, 22.11.2009-28.2.2010, S. 63 (m. Abb.). LITERATUR: Gabriele Kiesewetter, Hermann Pleuer 1863-1911. Leben und Werk, Stuttgart 2000, Nr. 1909,17 (m. Abb.). Franz Freiherr von Koenig-Fachsenfeld/Reinhard Freiherr von Koenig-Fachsenfeld, Werkverzeichnis Hermann Pleuer, 1911-1914, Archiv Schloss Fachsenfeld, Nr. 697. Nach dem Studium an den Akademien in Stuttgart und München wird Hermann Pleuer zunächst zu einem der wichtigsten Vertreter der impressionistischen Landschaftsmalerei in Süddeutschland. Dessen Vertreter in Frankreich hatten sich zumeist der Beschreibung moderner Freizeitkultur in den durch die Eisenbahn erschlossenen urbanen Naherholungsräumen gewidmet. 1875 entstehen Claude Monets berühmte Darstellungen des Pariser Bahnhofs Gare Saint Lazare, die wegweisend werden für die malerische und ästhetische Erschließung eines solch alltäglichen Ortes, der dadurch zum Symbol der Moderne wird. Im Zuge der Erweiterung des Stuttgarter Westbahnhofs beginnt Pleuer ab 1896 mit seiner eigenen Interpretation dieses neuartigen Motivs der Eisenbahn. Dabei setzt er sich intensiv mit dem mechanisch-technischen Aspekt auseinander, wie ein großes Konvolut aus Zeichnungen, Skizzen und Studien im Bestand der Staatsgalerie Stuttgart zeigt. Sein präziser Blick fällt dokumentarisch auf Räderwerk und Triebwerke der Lokomotiven, Montagewerkzeuge, Stellwerke und Weichen sowie auf die industrielle Bahnhofsarchitektur; der Mensch begegnet dem Betrachter als Reisender wie auch als dort beschäftigter Arbeiter. Die vor Ort entstandenen Zeichnungen dienen dabei oftmals als Vorstudien für ausgeführte Gemälde. Der Standpunkt mitten auf den Gleisen, bei dem die herannahenden Züge auf den Betrachter zukommen, zeigt die malerische Experimentierfreudigkeit, durch die die Dynamik des modernen Verkehrsmittels aus ungewöhnlicher Perspektive erlebbar gemacht wird. Weiteres Motivvokabular der Moderne bietet das elektrische Licht und dessen Reflexion auf dem Metall der Gleise sowie die Rauchwolken der Lokomotiven, die einen eindrucksvollen Effekt in der Dämmerung erzielen. Die Faszination Pleuers für die Eisenbahnthematik, für die er berühmt wird, liegt nicht zuletzt in deren Symbolik für ein sich beschleunigendes Leben in der Moderne im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert begründet, deren Mobilität und Schnelligkeit durch Industrie und Technik ermöglicht werden. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 14.34 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHermann Pleuer 1863 Schwäbisch Gmünd - 1911 Stuttgart Vor den Einfahrtshallen des Alten Stuttgarter Bahnhofs. 1909. Oil on canvas. Lower left signed and dated. With several labels on the reverse. 80 x 100 cm (31.4 x 39.3 in). PROVENANCE: Dr. Theodor Sproesser, Stuttgart (1913; with the label on the reverse). Kunsthaus Bühler, Stuttgart (1984; with the label on the reverse). Private collection Baden-Württemberg (since at least1974). EXHIBITION: Hermann Pleuer 1863-1911. Bilder aus dem Magazin, Galerie der Stadt Stuttgart, March 1 - 22, 1983. Der deutsche Impressionismus, Kunsthalle Bielefeld, November 22, 2009 - February 28, 2010, p. 63 (fig.). LITERATURE: Gabriele Kiesewetter, Hermann Pleuer 1863-1911. Leben und Werk, Stuttgart 2000, no. 1909, 17 (fig.). Franz Freiherr von Koenig-Fachsenfeld, Reinhard Freiherr von Koenig-Fachsenfeld, catalogue raisonné, 1911-1914, Archiev Schloß Fachsenfeld, no. 697. After studying at the academies in Stuttgart and Munich, Hermann Pleuer initially became one of the most important representatives of Impressionist landscape painting in southern Germany. Its representatives in France had mostly devoted themselves to describing modern leisure activities in urban recreational areas that had been made accessible by the railroad. In 1875, Claude Monet's famous depictions of Gare Saint Lazare in Paris became groundbreaking for the painterly and aesthetic development of such an ordinary motif that would become a symbol of modernity. In the course of the expansion of Stuttgart's Westbahnhof, Pleuer began his own interpretation of this novel motif in 1896. In doing so, he put strong focus on the mechanical-technical aspect, as can be seen in a large number of drawings, sketches, and studies in the inventory of the Staatsgalerie Stuttgart. He depicts the locomotives’ gears and engines, the tools, signal boxes and switches, as well as the station’s architecture with great precision The drawings were often made on site and served as preliminary studies for the paintings. The viewpoint in the middle of the tracks, with the approaching trains coming towards the viewer, shows the painterly joy of experimentation, through which the dynamics of the modern means of transportation become tangible from an unusual perspective. The electric light and its reflection on the metal of the tracks, as well as the clouds of smoke from the locomotives, which create an impressive effect at dusk, provide further modernist elements. Pleuer's fascination with the railroad theme, for which he would become famous, is largely owed to its symbolic significance for an accelerated modern life in the late 19th and early 20th centuries, when mobility at a higher speed became possible through industry and technology. [KT] Called up: December 9, 2023 - ca. 14.34 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Franz von Stuck 1863 Tettenweis - 1928 München Susanna im Bade. 1896. Öl auf Holz. Links unten signiert. Verso auf der Tafel mit roter und weißer Kreide sowie mit Bleistift von Hand nummeriert. 60 x 80 cm (23,6 x 31,4 in). • Früheste und einzigartige Version des dramatischen Themas im Œuvre des Münchner Malerfürsten der Jahrhundertwende. • Außergewöhnliche, erzählerische Komposition mit gewagter Blickführung, ägyptisierenden Details und in dunkel leuchtendem Kolorit. • Ein Jahr vor Entstehung wird Stuck zum Professor an der Münchner Kunstakademie ernannt. • 2022/23 widmete das Wallraff-Richartz Museum, Köln, dem Motiv der Susanna in der Kunst eine große Ausstellung. • Werke des bedeutenden deutschen Symbolisten befinden sich in internationalen Sammlungen wie dem Musée d'Orsay, Paris, im Metropolitan Museum of Art, New York sowie in der Eremitage, St. Petersburg. Mit einer Foto-Expertise von Dr. Heinrich Voss vom 21.12.1984 (in Kopie). PROVENIENZ: Sammlung Otto Hermann Claas (1849-1934), Königsberg (bis 1916: Cassirer/Helbing, 21.11.1916). Wohl Sammlung Theodor Schall, Baden Baden/Berlin (vom Vorgenannten erworben). Privatsammlung Bayern (1984 erworben). AUSSTELLUNG: Kunsthandlung Fleischmann, München 1897. LITERATUR: Heinrich Voss, Franz von Stuck 1863-1928. Werkkatalog der Gemälde mit einer Einführung in seinen Symbolismus, WVZ-Nr. 140/30 (m. Abb.). Die Kunst für Alle, Jg. 13, 1897/98, S. 46. Otto Julius Bierbaum, Stuck, Bielefeld 1899, S. 100: Abb. 107, S. 110. Fritz von Ostini, Franz von Stuck, in: Die Kunst für Alle, Jg. 19, Heft 2, Oktober 1903, Abb. S. 40. Fritz von Ostini, Franz von Stuck: Gesamtwerk, München 1909, S. 63 (m. Abb.). Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin, Hugo Helbing, München, Katalog der Sammlung Otto Herrmann Claass: nebst 10 Bildern aus Berliner Privatbesitz, Auktion 21.11.1916, Los 49 (m. Abb.). Wilhelm Lübke/Friedrich Haak, Die Deutsche Kunst des XIX. Jahrhunderts, Eßlingen 1918, S. 487. Otto Julius Bierbaum, Stuck, Bielefeld/Leipzig 1924, S. 110 (m. Abb. 85, S. 80). Galerie Wolfgang Ketterer, 87. Auktion, 26.11.1984, Nr. 14111. Franz von Stucks Œuvre beschäftigt sich in seinen oftmals der Antike aber auch anderen Ursprungserzählungen wie der Bibel entnommenen Figuren mit Archetypen und archetypischen menschlichen Verhaltensweisen. Die Frau, oftmals eng verbunden mit dem Element des Wassers, wird zur Nixe oder Nymphe, sie erscheint aber auch als kämpferische Amazone oder biblische Rächerin Judith. Zwischen aktiver und passiver Rolle bleibt sie allerdings stets Objekt des Begehrens für den Mann - wie dieser auch für sie. Das Geschlechterverhältnis insbesondere ist ein beständiges Thema, Begehren, Jagen, Necken, Kämpfen und Überwältigen, Locken - all diese zwischenmenschlichen Verhaltensweisen beleuchtet Stuck in seinen Gemälden. Auf die lose mit literarischen Vorlagen verknüpften Frauengestalten, deren Figuren immer auch ewiger Absolutheitscharakter innewohnt, richtet sich immer auch die Lust an der Betrachtung des weiblichen Körpers. Als malerisches Sujet findet sich diese Lust in der Malerei seit jeher in Darstellungen der badenden Venus, ihr biblisches Pendant bildet die biblische Erzählung der Susanna im Bade, die jedoch anders als die antike Verehrung der Körperlichkeit mit moralischen Ansprüchen verbunden ist. Stucks Aneignungen solcher Motive sind deshalb so interessant, weil sie den bisherigen Gehalt zwar präsentieren, aber mit einem befreiten Umgang überschreiben. Sie behandeln sämtlich erotische Themen wie hier aus dem Alten Testament und postulieren damit quasi psychologische Allgemeingültigkeit, so wie die beginnende Psychologie sie um 1900 zu deuten und einer Wertung durch Konventionen zu entziehen versuchte. Nicht die erotische Bedeutung ist das Neue an diesen Themen, denn diese Bedeutung hatten sie schon immer, sondern das Herausnehmen aus dem christlich-religiösen Zusammenhang und die restlose Anpassung an die zeitgenössische Vorstellung von Erotik und deren Erscheinungsformen. Die hier vorliegende Version des Motivs ist dabei die erste Beschäftigung Stucks mit dem Thema. Er nimmt Bezug auf andere Größen des Symbolismus wie Arnold Böcklin, der sich des Motivs 1888 angenommen hatte (Susanna im Bade, 1888, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg). Es folgen Szenen der vom voyeuristischen männlichen Blick überraschten Nymphe, in den Jahren 1904 und später 1912/13 beschäftigt er sich erneut mit der Susanna in Versionen, die den weiblichen Körper in seiner Gänze mehr in den Fokus rücken. Diese erste Version dagegen weist einen noch stärker erzählerischen und dramatischen Charakter mit kompositorischer und perspektivischer Behandlung der Szene auf. Außergewöhnlich für Stucks Schaffen ist auch der wohl gewissen Modeerscheinungen um die Jahrhundertwende zuzuschreibende Ägyptizismus, den er in den Dekorationen des steinernen, mit Darstellungen ägyptischer Gottheiten und Hieroglyphen versehenen Beckens vorführt. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 14.43 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Edward Cucuel 1875 San Francisco - 1954 Pasadena Waldschatten. Um 1910-20. Öl auf Leinwand. Links unten signiert. Verso auf dem Keilrahmen erneut signiert sowie betitelt. 61 x 50 cm (24 x 19,6 in). • Charakteristisches Motiv im Schaffen Cucuels, der sich vor allem den eleganten Frauengestalten in der Natur widmet • Cucuel zeigt sein malerisches Können im lebhaften Wechsel von Licht und Schatten, die die sommerliche Leichtigkeit spürbar machen • In der pastosen, impressionistischen Malweise fasziniert besonders das schillernde nuancenreiche Farbenspiel. PROVENIENZ: Privatsammlung Baden-Württemberg. Das Werk Edward Cucuels ist ab den 1910er Jahren geprägt durch eine heitere, unbeschwerte Freiluftmalerei, die er zunächst mit seinem Freund und Lehrmeister Leo Putz in Hartmannsberg am Chiemsee betreibt. Hier arbeiten die Maler über vier Jahre hinweg jeden Sommer Seite an Seite. Zuvor ist er hauptsächlich als Grafiker und Illustrator für die Presse tätig, unter anderem in den 1890er Jahren in New York, nachdem er in seiner Geburtsstadt San Francisco an der Kunstakademie und in Paris an der fortschrittlichen Académie Julian studiert hat. Ab 1914 ist Cucuel am Ammersee und anschließend am Starnberger See südlich von München ansässig, wo er eine Villa mit weitläufigem Seegrundstück besitzt. Dort führt er die zuvor gewählte Motivik fort: junge, elegant gekleidete Damen, die lässig drapiert im Grünen ihrem Freizeitvergnügen nachgehen. Im Stil unabhängiger von Putz werdend, fängt Cucuel seine Bilder durch einen ungebrochen flüssig bis flüchtigen Pinselduktus in satten Farbtönen von hoher Leuchtkraft ein. Den besonderen Reiz von Edward Cucuels Gemälden macht ihre spürbare Leichtigkeit und nonchalante Eleganz aus. Die Inszenierung der Modelle lässt die Grenze zwischen Pose und unbeobachteter Spontaneität verschwimmen, in der lockeren Ausführung erscheint die Malerei als angenehmer sommerlicher Zeitvertreib. Häufig verwendet er dabei nicht nur den Pinsel, sondern trägt die Farbe in breiten Strichen mit dem Malmesser auf, wodurch seine Motive trotz der hellen, pastelligen Farben eine solide Körperlichkeit erlangen. Insbesondere die Welt der schönen, unbeschwerten jungen Frau in sommerlicher Landschaft ist eines der erfolgreichsten Motive von Edward Cucuel. Seine Bilder vom Ufer des Starnberger Sees und dem zur Villa gehörenden Park sowie der kleinen, lichterfüllten Wäldchen im Umland sind Ausdruck einer Lebenshaltung, die gleichzeitig charakteristisch für eine bestimmte Gesellschaftsschicht ist, der der Maler in seiner vom Spätimpressionismus beeinflussten Malweise auf exemplarische Weise huldigt. Irisierende Lichtreflexe auf der weißen Kleidung der Damen, hier vor dem intensiven Grün der Zweige und des von einzelnen Sonnenflecken erhellten Erdbodens, geben der Szene jenen imaginären Zauber des optisch Entrückten, der für viele Arbeiten Cucuels aus dieser Epoche so charakteristisch ist. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 14.58 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONEdward Cucuel 1875 San Francisco - 1954 Pasadena Waldschatten. Um 1910-20. Oil on canvas. Lower left signed. Signed, as well as titled on the reverse. 61 x 50 cm (24 x 19.6 in). • A characteristic motif in Cucuel's oeuvre, which is primarily dedicated to elegant female figures in nature • Cucuel demonstrates his painting skills in the lively alternation of light and shadow, which make the summery lightness palpable • In the impasto, impressionistic painting style, the dazzling, nuanced play of colors is particularly fascinating. PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg. From the 1910s onward, Edward Cucuel's work was characterized by cheerful, carefree open-air painting, which he initially pursued with his friend and teacher Leo Putz in Hartmannsberg am Chiemsee, where the painters worked side by side every summer for four years. Prior to this, he worked mainly as a graphic artist and illustrator for the press, such as in New York in the 1890s, after studying at the Academy of Fine Arts in his native city of San Francisco and at the progressive Académie Julian in Paris. From 1914, Cucuel lived on Lake Ammersee and then on Lake Starnberg south of Munich, where he owned a villa with an extensive lakeside garden. He continued the motif he had previously chosen: young, elegantly dressed ladies, casually draped and enjoying their leisure time in the countryside. Becoming more independent in style from Putz, Cucuel captured his pictures with an unbroken fluid to fleeting brushstroke in rich colors of high luminosity. The special appeal of Edward Cucuel's paintings lies in their palpable lightness and nonchalant elegance. The staging of the models blurs the boundary between pose and unobserved spontaneity; in the relaxed execution, painting appears to be a pleasant summer pastime. He often not only uses a brush, but also applies the paint in broad strokes with a painting knife, giving his motifs a solid physicality despite the bright, pastel colors. In particular, the world of the beautiful, carefree young woman in a summer landscape is one of Edward Cucuel's most successful motifs. His pictures of the shores of Lake Starnberg and the park belonging to the villa, as well as the small, light-filled woods in the surrounding countryside, are an expression of an attitude to life that is also characteristic of a certain social class, to which the painter paid homage in his late Impressionist-influenced style of painting. Iridescent reflections of light on the white clothing of the ladies, here against the intense green of the branches and the ground illuminated by individual patches of sunlight, give the scene that enraptured magic that is so characteristic of many of Cucuel's works from this period. [KT] Called up: December 9, 2023 - ca. 14.58 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Alexej von Jawlensky 1864 Torschok - 1941 Wiesbaden Meditation N. 29. 1934. Öl auf leinenstrukturiertem Papier, auf Karton kaschiert. Links unten monogrammiert sowie rechts unten datiert. Verso zusätzlich von Lisa Kümmel bezeichnet 'A. Jawlensky, 1934 N. 29'. 17 x 12,5 cm (6,6 x 4,9 in). Unterlagekarton: 27,3 x 22,6 cm (10,7 x 8,8 in). [AW]. • Von außergewöhnlich klarer, strahlender Farbigkeit. • Das menschliche Antlitz verändert Jawlensky mit großer Empathie zu einer ikonischen Erscheinung religiösen Gefühls. • Die 'Meditationen' sind die letzte, in großer Zurückgezogenheit geschaffene Werkreihe Jawlenskys. PROVENIENZ: Galerie Valentien, Stuttgart. Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Maria Jawlensky/Lucia Pieroni-Jawlensky/Angelica Jawlensky, Alexej Jawlensky. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Bd. III (1934-1937), München 1993, S. 54, WVZ-Nr. 1494 (m. Abb.). Clemens Weiler, Alexej Jawlensky, Köln 1959, Kat.-Nr. 332 (m. Abb. S. 250). Alexej von Jawlensky, zit. nach: Tayfun Belgin (Hrsg.), Alexej von Jawlensky, Reisen, Freunde, Wandlungen, Ausst.-Kat. Museum am Ostwall, Dortmund, Heidelberg 1998, S. 119. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 18.19 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONAlexej von Jawlensky 1864 Torschok - 1941 Wiesbaden Meditation N. 29. 1934. Oil on paper with a canvas structure, laminated on cardboard. Lower left monogrammed and lower right dated. Inscribed 'A. Jawlensky, 1934 N. 29' by Lisa Kümmel on the reverse. 17 x 12.5 cm (6.6 x 4.9 in). Backing cardboard: 27,3 x 22,6 cm (10,7 x 8,8 in). [AW]. • With exceptionally clear and radiant colors. • Jawlensky transforms the human face with great empathy into an iconic appearance of religious feeling. • The 'Meditations' are Jawlensky's last series of works that were created in great seclusion. PROVENANCE: Galerie Valentien, Stuttgart. Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Maria Jawlensky/Lucia Pieroni-Jawlensky/Angelica Jawlensky, Alexej Jawlensky. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, vol. III (1934-1937), Munich 1993, p. 54, no. 1494 (fig.). Clemens Weiler, Alexej Jawlensky, Cologne 1959, cat. no. 332 (fig. p. 250). Alexej von Jawlensky, quoted from: Tayfun Belgin (ed.), Alexej von Jawlensky, Reisen, Freunde, Wandlungen, ex. cat. Museum am Ostwall, Dortmund, Heidelberg 1998, p. 119. Called up: December 9, 2023 - ca. 18.19 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Karl Schmidt-Rottluff 1884 Rottluff bei Chemnitz - 1976 Berlin Herbst (Herbstliche Blätter). 1945. Aquarell und Tusche. Rechts oben signiert. Links unten mit der Werknummer '454' bezeichnet. Auf festem Papier. 49,5 x 64 cm (19,4 x 25,1 in), blattgroß. [JS]. • Herausragendes Beispiel für Schmidt-Rottluffs meisterliche Kombination aus leuchtender Farbigkeit und Klarheit der Form. • Souverän ins Format gesetzte Inszenierung des herbstlichen Farb- und Formenspiels. • Reduzierte Komposition: durch ihre Flächigkeit, Reduktion und formale Vereinfachung von faszinierender Modernität. • Die Technik des Aquarells ist in Schmidt-Rottluffs Schaffen von zentraler Bedeutung und dominiert gerade in den Kriegsjahren sein Œuvre. • 2011 in Christiane Remms Überblickswerk zu Schmidt-Rottluffs Aquarellen publiziert. Die Arbeit ist im Archiv der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung, Berlin, dokumentiert. PROVENIENZ: Privatsammlung Baden-Württemberg (seit 2008). LITERATUR: Christiane Remm, Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle, hrsg. v. Magdalena M. Moeller, Brücke-Museum, Berlin 2011, S. 61-63 (Abb. 69, S. 64). Nagel, Stuttgart, Auktion 15.10.2008, Los 667(dort unter dem Titel 'Vase mit herbstlichen Blättern'). 'Trotz massiver Diffamierung seines Werkes und des folgenden Malverbotes hatte Schmidt-Rottluff [..] weitergearbeitet. [..] Besondes die nun entstehenden Stilleben lassen eine sehr intensive, persönliche 'Zwiesprache' zwischen dem Künstler und seinem Bildgegenstand erkennen. [..] In [..] Herbst [..] zeigt sich Schmidt-Rottluff als Meister der auf das Elementarste vereinfachten Bildsprache. Einzelne, isolierte Bildobjekte auf neutraler, karger, räumlich nicht definierter Grundfläche [..] stehen vielleicht für die stille Verzweiflung des Malers, aber ebenso für den unerschütterlichen Willen zum Durchhalten in Zeiten der Einschränkung.' Christiane Remm, Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle, Berlin 2011, S. 61-63. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 18.32 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONKarl Schmidt-Rottluff 1884 Rottluff bei Chemnitz - 1976 Berlin Herbst (Herbstliche Blätter). 1945. Watercolor and India ink. Signed in upper right. Lower left inscribed with the work number '454'. On firm paper. 49.5 x 64 cm (19.4 x 25.1 in), the full sheet. [JS]. • Remarkable example of Schmidt-Rottluff's combination of radiant colors and clear forms. • Poised orchestration of an autumnal play of forms and colors. • Reduced composition: fascinating modernity attained through reduction and formal simplification. • Watercolors make for a key group within Schmidt-Rottluff's creation, the technique dominated his œuvre especially during the war years. • In 2011, Christiane Remm's monography on Schmidt-Rottluff's watercolors was published. The work is documented in the archive of the Karl and Emy Schmidt-Rottluff Foundation, Berlin, dokumentiert. PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Christiane Remm, Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle, published by Magdalena M. Moeller, Brücke-Museum, Berlin 2011, pp. 61-63 (illu. 69, p. 64). Nagel, Stuttgart, auction on October 15, 2008, lot 667 (titled 'Vase mit herbstlichen Blättern'). 'Despite massive defamation of his work and the subsequent ban, Schmidt-Rottluff [..] continued to work. [..] Especially the still lifes that were made at that time reveal a very intensive, personal 'dialogue' between the artist and his subject. [.] In [..] 'Autumn' [..] Schmidt-Rottluff shows his mastery in simplifying the pictorial language to the most elementary. Individual, isolated pictorial objects on a neutral, sparse, spatially undefined base [..] perhaps stand for the painter's quiet despair, but also for the unshakable will to persevere in times of restriction.' Christiane Remm, Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle, Berlin 2011, pp. 61-63. Called up: December 9, 2023 - ca. 18.32 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Hermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Selbstbildnis mit hohem Hut und Zigarette. 1910. Öl auf Malkarton. 49 x 37 cm (19,2 x 14,5 in). Verso mit der Ölskizze eines Mädchenaktes (Hülsewig-Johnen/Reipschläger 55). [JS]. • Stenner zeigt sich in diesem bemerkenswerten Selbstbildnis als selbstbewusster und entschlos- sener junger Künstler, ausgestattet mit Malerkit- tel und Zylinder als Attributen • Die Selbstbildnisse sind eine der wichtigsten Werkgruppen im Œuvre von Hermann Stenner • Die ausgesprochen lässige Selbstdarstellung in diesem Bild ist im Gesamtwerk einzigartig. PROVENIENZ: Aus dem Nachlass des Künstlers. Familie Stenner, Bielefeld. Max Kämper, Bielefeld. Hermann Stenner, New York. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Bilder und Zeichnungen von Hermann Stenner und seinen Freunden aus dem Hölzel-Kreis, Willi Baumeister, Johannes Itten, Alfred Pellegrini, Oskar Schlemmer, Adolf Hölzel, Galerie im Rathaus Bocholt, 1982. Hermann Stenner 1891-1914, Kunsthalle Bielefeld, 2.6.-25.8.1991; Städtische Galerie, Albstadt, 8.9.-27.10.1991; Galerie der Stadt Sindelfingen, 8.11.-29.12.1991, Kat.-Nr. 3, (m. Abb. S. 58). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.12.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunst-Museum Ahlen, 21.5.-16.7.2000; Museum Baden, Solingen, 20.8.-17.9.2000 (m. Abb. S. 22). Zwischentöne. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, 16.11.2000-21.1.2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle, 28.1.-11.3.2001. Malerei der Hamburgischen Sezession (1919-1933) aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwicklungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001. Verlorene Nähe. Bilder vom Menschen in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottdorf, Schleswig, 1.12.2001-20.1.2002; Städtische Galerie in der Reithalle, Schloss Neuhaus, Paderborn, 1.2.-13.3.2002; Kunsthaus Kaufbeuren, 22.3.-15.6.2002, Kat.-Nr. 106 (Abb. S. 28). Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis, Malerei und Grafik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13.4.-17.8.2003, Kat.-Nr. 2 (m. Abb.19, S. 25). Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, 1.6.-31.8.2003; Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 27.9.-16.11.2003 Sammlung Bunte, Positionen der Klassischen Moderne, Kunst-Museum Ahlen, 25.02.-28.05.2007 (m. Ganzs. Farbabb. S. 185); Lyonel Feininger Galerie, Quedlinburg, 01.12.07-02.03.2008; Städtische Galerie Böblingen 16.03.-29.06.2008; Museum Moderne Kunst, Passau 09.08.-29.09.2008; Egon Schiele Art Centrum, Krumau 31.10.08.-01.02.2009; Kunsthalle Jesuitenkirche, Aschaffenburg 29.05.-06.09.2009; Ernst Barlach Stiftung Güstrow 27.09.09-17.01.2010; Kunsthaus Apolda Avantgarde 24.01.-05.04.2010; Hermann Stenner, Hymnen an das Leben, Werke aus der Sammlung Bunte,Städtisches Museum Engen + Galerie, 28.02.-02.07.2023, Kat.-Nr. 12 (m. Ganzs. Abb. S. 38); Kunsthaus Apolda Avantgarde, 09.07.-03.09.2023. LITERATUR: Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Werkverzeichnis der Gemälde, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, WVZ-Nr. 38 (m. Abb. S. 49). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, S. 20, WVZ-Nr. G 35 (m. Abb. 77). Gustav Vriesen (Hrsg.), Hermann Stenner 1891-1914, Bielefeld 1956, Kat.-Nr. 1. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.00 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Selbstbildnis mit hohem Hut und Zigarette. 1910. Oil on cardboard. 49 x 37 cm (19.2 x 14.5 in). With an oil sketch of a nude girl on the reverse (Hülsewig-Johnen/Reipschläger 55). [JS]. PROVENANCE: From the artist's estate. Stenner family, Bielefeld. Max Kämper, Bielefeld. Hermann Stenner, New York. Hermann-Josef Bunte Collection, Bielefeld. EXHIBITION: Bilder und Zeichnungen von Hermann Stenner und seinen Freunden aus dem Hölzel-Kreis, Willi Baumeister, Johannes Itten, Alfred Pellegrini, Oskar Schlemmer, Adolf Hölzel, Galerie im Rathaus Bocholt, Bocholt 1982. Hermann Stenner 1891-1914, Kunsthalle Bielefeld, 2/6 - 25/8/1991 / Städtische Galerie Albstadt, 8/9 - 27/10/1991, Galerie der Stadt Sindelfingen, 8/11 - 29/12/1991, cat. no. 3, (fig. p. 58). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1/12/1999 - 5/3/2000 / Kunsthalle Wilhelmshaven, 12/3 - 24/4/2000 / Kunst-Museum Ahlen, 21/5 - 16/7/2000, Museum Baden, Solingen, 20/8 - 17/9/2000 (fig. p. 22). Zwischentöne-Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, 16/11/2000 - 21/1/2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle, 28/1 - 11/3/2001. Malerei der Hamburgischen Sezession (1919-1933) aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin 24/4 - 17/6/2001. Zwischentöne. Sonderentwickungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29/6 - 26/8/2001. Verlorene Nähe.Menschenbilder in der Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottdorf, Schleswig, 1/12/2001 - 20/1/2002, Städtische Galerie in der Reithalle Schloss Neuhaus, Paderborn, 1/2 - 13/3/2002 / Kunsthaus Kaufbeuren, 21/3 - 9/6/2002, cat. no. 106 (fig. p. 28). Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis, Malerei und Graphik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13/4 - 17/8/2003, cat. no. 2 (fig.19, p. 25). Hermann Stenner, Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, 1/6 - 31/8/2003 / Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 27/9 - 16/11/2003. LITERATURE: Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, S. 20, WVZ-Nr. G 35 (m. Abb. 77). Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Werkverzeichnis der Gemälde, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, WVZ-Nr. 38 (m. Abb. S. 49) Gustav Vriesen (Hrsg,), Hermann Stenner 1891-1914, Bielefeld 1956, Kat.-Nr.1. . Called up: December 9, 2023 - ca. 16.00 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Ida Kerkovius 1879 Riga (Lettland) - 1970 Stuttgart Porträtkopf. 1915. Öl auf Leinwand. Verso 'Blumenstillleben'. 65 x 47 cm (25,5 x 18,5 in). [AW]. • Werke aus dieser frühen Schaffensphase werden außerordentlich selten auf dem internationalen Auktionsmarkt angeboten •Die Einflüsse der kubistischen Malerei finden Eingang in dieses Werk von Ida Kerkoviustionalen Auktionsmarkt angeboten . Wir danken Herrn Uwe Jourdan, Stuttgart, für die freundliche Auskunft. Die Arbeit ist in dem in Vorbereitung befindlichen Werkverzeichnis von Uwe Jourdan, Stuttgart, unter der WVZ-Nr. 1068 verzeichnet. PROVENIENZ: Galerie Thomas, München. Privatsammlung Baden-Württemberg. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Bielefeld. AUSSTELLUNG: Ida Kerkovius, Kunstnernes Hus, Oslo, 1966, Kat.-Nr. 42. Ida Kerkovius. Gemälde, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen, Heidelberger Kunstverein, 26.6.-24.7.1966, Kat.-Nr. 26. Ida Kerkovius. 100 Gemälde, Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen, Lempertz Contempora, Köln, 1.-29.10.1971, Kat.-Nr. 3. Ida Kerkovius, Der Gemeinnützige Verein Erlangen, 21.10.-18.11.1973, Kat.-Nr. 185. Ida Kerkovius 1879-1970. Gesichter, Bilder, Zeichnungen aus sieben Jahrzehnten, Galerie der Stadt Stuttgart, 19.7.-16.9.1979, Kat.-Nr. 14. Ida Kerkovius. Bilder, Gouachen, Pastelle, Aquarelle, Zeichnunge, Galerie Thomas, München, 27.11.1980-5.2.1981. Die Sammlung Bunte. Expressionistische Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, Ausstellungszentrum Gut Altenkamp, Papenburg, 12.7.-25.10.2020. Die Malerei war mein Ein und Alles. Hölzels Schülerinnen Ida Kerkovius, Lilly Hildebrandt und Maria Lemmé, Adolf Hölzel Stiftung, Stuttgart, 2.4.-10.9.2023. LITERATUR: Kurt Leonhard, Ida Kerkovius. Leben und Werk, Köln 1967, Kat.-Nr. 19 (m. Abb.). Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.12 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONIda Kerkovius 1879 Riga (Lettland) - 1970 Stuttgart Porträtkopf. 1915. Oil on canvas. 65 x 47 cm (25.5 x 18.5 in). Called up: December 9, 2023 - ca. 16.12 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Hermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Verkündigung an die Hirten. 1912. Aquarell, Gouache, Tusche und Bleistift. Auf chamoisfarbenem Zeichenpapier. 21,2 x 27 cm (8,3 x 10,6 in), Blattgröße. Variante zu dem Gemälde 'Die gelbe Blume' (Hülsewig-Johnen/Reipschläger 106). [JS]. •Spielerisch leicht komponierte Zeichnung, die geschickt entlang der Grenze hin zur Abstraktion balanciert •Papierarbeiten in solch kräftiger Farbigkeit sind von großer Seltenheit. PROVENIENZ: Aus dem Nachlass des Künstlers (verso mit dem Nachlassstempel und der handschriftlichen Registriernummer '12/205 122'). Erich Stenner, Bielefeld (aus dem Nachlass erhalten). Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Hermann Stenner. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Städtische Galerie, Abstadt, 4.12.1977-29.1.1978, Kat.-Nr. 58. Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.11.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunstmuseum Ahlen, 21.5.-16.7.2000; Museum Baden, Solingen 20.8.-17.9.2000. Malerei der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus Am Waldsee, Berlin 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwickungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001. Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis. Malerei und Grafik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13.4.-17.8.2003, Kat.-Nr. 23 (m. Abb. 25). Hermann Stenner, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Kloster Cismar, 31.7.-23.10.2005. Hermann Stenner 1891-1914. Von Bielefeld nach Meersburg – Ein Maler an der Schwelle zur Moderne, Schloss Achberg, 21.4.-14.10.2007, Kat.-Nr. 74 (m. Abb. 74). Sammlung Bunte: Positionen der klassischen Moderne, Kunstmuseum Ahlen, 25.2.-28.5.2007; Museum Lyonel Feininger, Quedlinburg, 1.12.2007-2.3.2008; Städtische Galerie, Böblingen, 16.3.-29.6.2008. Adolf Hölzel und sein Kreis. Positionen der klassischen Moderne aus der Sammlung Bunte, Museum Moderner Kunst Wörlen, Passau, 9.8.-28.9.2008. Hermann Stenner in der Sammlung Bunte, Egon Schiele Art Centrum, Cesky Krumlov, 31.10.2008-1.2.2009. Sammlung Bunte. Positionen der klassischen Moderne, Kunsthaus Apolda Avantgarde, 24.1-5.4.2010. Wege in die klassische Moderne. Sammlung Bunte, Schloss Achberg 17.4.-25.7.2010; Neues Schloss Kißlegg, 18.4.-18.7.2010. Der Westfälische Expressionismus, Kunsthalle Bielefeld, 31.10.2010-20.2.2011. LITERATUR: Jutta Hülsewig-Johnen/Nicole Peterlein, Hermann Stenner. Aquarelle und Zeichnungen, Werkverzeichnis, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., München 2010, WVZ-Nr. 1198 (m. Abb. S. 103). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, WVZ-Nr. Z 1176 (m. Abb. 176, S. 228). Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Malerei um 1900. Sonderleistungen der klassischen Moderne. Die Hamburgische Secession. Der neue Realismus, Ausst.-Kat. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Cismar 1996, Kat.-Nr. 11, Abb. S. 44. Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Bielefeld 2003, S. 138. Burkhard Leismann (Hrsg.), Sammlung Bunte: Positionen der klassischen Moderne, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Ahlen, Bramsche 2007, S. 327 (m. Abb. S. 222). Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.22 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Verkündigung an die Hirten. 1912. Watercolor, gouache, India ink and pencil. Auf chamoisfarbenem Zeichenpapier. 21.2 x 27 cm (8.3 x 10.6 in), Blattgröße. Variante zu dem Gemälde 'Die gelbe Blume' (Hülsewig-Johnen/Reipschläger 106). [JS]. PROVENANCE: Aus dem Nachlass des Künstlers (verso mit dem Nachlassstempel und der handschriftlichen Registriernummer '12/205 122'). Erich Stenner, Bielefeld (aus dem Nachlass erhalten). Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. EXHIBITION: Hermann Stenner. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Städtische Galerie, Abstadt, 4.12.1977-29.1.1978, Kat.-Nr. 58. Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.11.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunstmuseum Ahlen, 21.5.-16.7.2000; Museum Baden, Solingen 20.8.-17.9.2000. Malerei der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus Am Waldsee, Berlin 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwickungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001. Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis. Malerei und Grafik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13.4.-17.8.2003, Kat.-Nr. 23 (m. Abb. 25). Hermann Stenner, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Kloster Cismar, 31.7.-23.10.2005. Hermann Stenner 1891-1914. Von Bielefeld nach Meersburg – Ein Maler an der Schwelle zur Moderne, Schloss Achberg, 21.4.-14.10.2007, Kat.-Nr. 74 (m. Abb. 74). Sammlung Bunte: Positionen der klassischen Moderne, Kunstmuseum Ahlen, 25.2.-28.5.2007; Museum Lyonel Feininger, Quedlinburg, 1.12.2007-2.3.2008; Städtische Galerie, Böblingen, 16.3.-29.6.2008. Adolf Hölzel und sein Kreis. Positionen der klassischen Moderne aus der Sammlung Bunte, Museum Moderner Kunst Wörlen, Passau, 9.8.-28.9.2008. Hermann Stenner in der Sammlung Bunte, Egon Schiele Art Centrum, Cesky Krumlov, 31.10.2008-1.2.2009. Sammlung Bunte. Positionen der klassischen Moderne, Kunsthaus Apolda Avantgarde, 24.1-5.4.2010. Wege in die klassische Moderne. Sammlung Bunte, Schloss Achberg 17.4.-25.7.2010; Neues Schloss Kißlegg, 18.4.-18.7.2010. Der Westfälische Expressionismus, Kunsthalle Bielefeld, 31.10.2010-20.2.2011. LITERATURE: Jutta Hülsewig-Johnen/Nicole Peterlein, Hermann Stenner. Aquarelle und Zeichnungen, Werkverzeichnis, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., München 2010, WVZ-Nr. 1198 (m. Abb. S. 103). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, WVZ-Nr. Z 1176 (m. Abb. 176, S. 228). Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Malerei um 1900. Sonderleistungen der klassischen Moderne. Die Hamburgische Secession. Der neue Realismus, Ausst.-Kat. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Cismar 1996, Kat.-Nr. 11, Abb. S. 44. Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Bielefeld 2003, S. 138. Burkhard Leismann (Hrsg.), Sammlung Bunte: Positionen der klassischen Moderne, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Ahlen, Bramsche 2007, S. 327 (m. Abb. S. 222). Called up: December 9, 2023 - ca. 16.22 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Heiliger Sebastian. 1911/12. Öl auf Leinwand. Verso signiert. 95,5 x 75,5 cm (37,5 x 29,7 in). [JS]. PROVENIENZ: Aus dem Nachlass des Künstlers. Fritz Stenner, Bielefeld. Familienbesitz Stenner. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Große Kunstausstellung Minden, 1914, Kat.-Nr. 183. Wilhelm Morgner - Hermann Stenner, Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, 2.-30.5.1954, Kat.-Nr. 37 (m. Abb.). Hermann Stenner 1891-1914, Kunsthalle Bielefeld, 2.6.-25.8.1991; Städtische Galerie, Albstadt, 8.9.-27.10.1991; Galerie der Stadt Sindelfingen, 8.11.-29.12.1991, Kat.-Nr. 15 (m. Abb. S. 70). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte, Städtische Galerie, Papenburg, 5.11.1995-25.2.1996; Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Kloster Cismar, 31.3.-27.5.1996, Kat.-Nr. 10 (m. Abb. S. 43). Dauerleihgabe im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum, Schloss Gottdorf (seit 1996). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.12.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunstmuseum Ahlen, 21.5.-16.7.2000; Museum Baden, Solingen, 20.8.-17.9.2000. Zwischentöne. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, 16.11.2000-21.1.2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle/Saale, 28.1.-11.3.2001. Malerei der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin, 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwicklungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001, Kat.-Nr. 25 (m. Abb. S. 26). Verlorene Nähe. Bilder vom Menschen in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottdorf, Schleswig, 1.12.2001-20.1.2002; Städtische Galerie in der Reithalle, Schloss Neuhaus, Paderborn, 1.2.-13.3.2002; Kunsthaus Kaufbeuren, 22.3.-15.6.2002, Kat.-Nr. 109 (m. Abb. S.30). Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis, Malerei und Grafik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13.4.-17.8.2003, Kat.-Nr. 11 (m. Abb. 34, S. 42). Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, 1.6.-31.8.2003; Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 27.9.-16.11.2003 Sammlung Bunte, Positionen der Klassischen Moderne, Kunst-Museum Ahlen, 25.02.-28.05.2007 (m. Ganzs. Farbabb. S. 211); Lyonel Feininger Galerie, Quedlinburg, 01.12.07-02.03.2008; Museum Moderne Kunst, Passau 09.08.-29.09.2008; Egon Schiele Art Centrum, Krumau 31.10.08.-01.02.2009; Ernst Barlach Stiftung Güstrow 27.09.09-17.01.2010; Kunsthaus Apolda Avantgarde 24.01.-05.04.2010 Hermann Stenner, Hymnen an das Leben, Werke aus der Sammlung Bunte,Städtisches Museum Engen + Galerie, 28.02.-02.07.2023, Kat.-Nr. 21 (m. Ganzs. Farbabb. S.46 ); Kunsthaus Apolda Avantgarde, 09.07.-03.09.2023;. LITERATUR: Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Werkverzeichnis der Gemälde, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, WVZ-Nr. 87 (m. Abb. S. 113). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, S. 33 sowie WVZ-Nr. G 86. Hermann Stenner 1891-1914, Ausst.-Kat. Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, hrsg. von Hans Hildebrandt, Bielefeld 1956, Kat.-Nr. 105. Hermann Stenner 1891-1914. Gemälde und Arbeiten auf Papier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld u. a., hrsg. von Hans-Michael Herzog, Bielefeld 1991, S. 14f., S. 22. „Hermann Stenner wäre einer der besten Maler Deutschlands geworden, wenn nicht der sinnlose, verbrecherische Krieg seine Opfer geholt hätte… [Er] ist mir ein intensivster Bestand meiner Jugend gewesen, als Vorbild jugendlichen Elans, künstlerischem Wollen und Intensität des verantwortlichen Eifers, ein heiterer und klarster Mensch, ein werdender Künstler.“ Willi Baumeister Der heilige Sebastian war der Legende nach ein römischer Soldat, der seit dem 4. Jahrhundert als Märtyrer in der katholischen Kirche verehrt wird. Der Überlieferung zufolge hatte sich Sebastian als Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof öffentlich zum Christentum bekannt und notleidenden Christen geholfen, woraufhin ihn Diokletian zum Tode verurteilte und von numidischen Bogenschützen erschießen ließ. Im Glauben, er sei tot, ließ man ihn danach liegen. Sebastian war jedoch nicht tot, sondern wurde von einer frommen Irene, die ihn eigentlich für das Begräbnis vorbereiten wollte, gesund-gepflegt. Das Martyrium des hl. Sebastian wird in der bildenden Kunst bereits im 5. Jahrhundert dargestellt. Zu den Attributen des Heiligen gehören Pfeile, die seine Brust und mageren Körper durchbohren. Dabei ist der Heilige häufig an einen Baum gebunden, bisweilen wird auch die gesamte Beschießungsszene gezeigt und auch die Auffindung durch Irene thematisiert. Spätestens seit der Renaissance, besonders bei Andrea Mantegna, ist der hl. Sebastian als standhafte Ikone männlicher, adonisgleicher Schönheit zu sehen. Und wie geht Hermann Stenner mit diesem Thema um? Zunächst ist zu bemerken: Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Stenner noch kaum mit der Darstellung religiöser Thematik beschäftigt. Und diesem doch recht weltlichen, gleichwohl dramatisch in Szene gesetzten, elegisch an einen Baum gelehnten Jüngling fehlen die entscheidenden Attribute. Der Körper ist unversehrt, allenfalls ist sein rechter Arm an den Baum gebunden, der linke ragt über dem Kopf gehalten aus dem Bild. In einer weiteren Version dieses Themas sind beide Hände gebunden. Über die Entstehung des Bildes äußert sich der Künstler nicht, so dass nur der Titel eine mögliche Interpretation nahelegt: Ist es möglicherweise eine sehr persönliche Umsetzung eines noch unversehrten Körpers? Ein inspirierendes Studium der reichhaltigen Literatur zu diesem Thema wird Stenner angeleitet haben, sich diesem Thema zu nähern, um sich selbst in einer ‚vergleichbaren‘ Szene zu sehen. Vielleicht auch zum Ausdruck zu bringen, in welcher geistigen Verfassung er sich befindet als noch sehr jugendlicher, gerade volljährig gewordener Mensch vor dem Wechsel zu einem freischaffenden Künstler, ohne die schützenden Hände der Kunst-Akademie und seines Lehrers Adolf Hölzel, ausgesetzt den Pfeilen der Kritiker? Und noch etwas ist bemerkenswert: Stenner konfrontiert die Betrachter zum ersten Mal mit einem männlichen nackten Oberkörper in dieser Nahsicht, einem ausdruckstarken, durchmodellierten Körper. Und er gibt sich zu erkennen mit dem feinen Gesicht. [MvL] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.28 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Heiliger Sebastian. 1911. Oil on canvas. 95.5 x 75.5 cm (37.5 x 29.7 in). Called up: December 9, 2023 - ca. 16.28 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Heilige von Engeln verehrt. 1913. Öl auf Leinwand. 81 x 55,5 cm (31,8 x 21,8 in). [JS]. • In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg fand Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ in Künstlerkreisen große Beachtung. In diesem Buch erscheint das Licht als metaphorisches Medium für geistige Erkenntnis • Beseelt und getragen von einer mystisch transitorischen Lichtregie, ist die Figur der Heiligen dem irdischen Raum enthoben • Ein Werk von kompositorischer Raffinesse und großer Dynamik. PROVENIENZ: Aus dem Nachlass des Künstlers. Familienbesitz Stenner. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Hermann Stenner 1891-1914, Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, 9.9.-14.10.1956 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett), Kat.-Nr. 192. Hermann Stenner 1891-1914, Spendhaus Reutlingen, 5.5.-16.6.1974, Kat.-Nr. 31. Die Sammlung Hermann-Josef Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Cismar, 31.3.-27.5.1996, Kat.-Nr. 12 (m. Abb. S. 47). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.12.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunst-Museum Ahlen, 21.5.-16.7.2000, Museum Baden, Solingen, 20.8.-17.9.2000. Zwischentöne. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, 16.11.2000-21.1.2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle/Saale, 28.1.-11.3.2001. Malerei der Hamburgischen Sezession (1919-1933) aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin, 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwicklungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001 (m. Abb. S. 27). Verlorene Nähe. Bilder vom Menschen in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottdorf, Schleswig, 1.12.2001-20.1.2002; Städtische Galerie in der Reithalle, Schloss Neuhaus, Paderborn, 1.2.-13.3.2002; Kunsthaus Kaufbeuren, 22.3.-15.6.2002, Kat.-Nr. 111 (m. Abb. S. 32). Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis. Malerei und Grafik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, 13.4.-17.8.2003, Kat.-Nr. 17 (m. Abb. 40, S. 49). Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, 1.6.-31.8.2003; Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 27.9.-16.11.2003. Sammlung Bunte, Positionen der Klassischen Moderne, Kunst-Museum Ahlen, 25.02.-28.05.2007 (m. Ganzs. Farbabb. S. 237);Lyonel Feininger Galerie, Quedlinburg, 01.12.07-02.03.2008; Museum Moderne Kunst, Passau 09.08.-29.09.2008; Egon Schiele Art Centrum, Krumau 31.10.08.-01.02.2009; Ernst Barlach Stiftung Güstrow 27.09.09-17.01.2010; Kunsthaus Apolda Avantgarde 24.01.-05.04.2010; El Greco und die Moderne, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, 28.04.-12.08.2012 (m. Abb. S. 308) Hermann Stenner, Hymnen an das Leben, Werke aus der Sammlung Bunte,Städtisches Museum Engen + Galerie, 28.02.-02.07.2023, Kat.-Nr. 79 (m. Ganzs. Farbabb. S. 122); Kunsthaus Apolda Avantgarde, 09.07.-03.09.2023. LITERATUR: Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Werkverzeichnis der Gemälde, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, WVZ-Nr. 159 (m. Abb. S. 217). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, WVZ-Nr. G 157 sowie S. 55 (m. SW-Abb. 114). Gustav Vriesen (Hrsg.), Hermann Stenner 1891-1914, Bielefeld 1956, S. 160. Carsten Meyer-Tönnesmann, in: Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Malerei um 1900. Sonderleistungen der klassischen Moderne. Die Hamburgische Secession. Der neue Realismus, Hamburg/Cismar 1996, S. 46 . Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.43 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONHermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Heilige von Engeln verehrt. 1913. Oil on canvas. 81 x 55.5 cm (31.8 x 21.8 in). [JS]. PROVENANCE: From the artist's estate. In possession of the Stenner family. Hermann-Josef Bunte Collection, Bielefeld. EXHIBITION: Hermann Stenner 1891-1914, Städtisches Kunsthaus Bielefeld, November 9 - October 14, 1956 (with the label on the stretcher) / Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Bielefeld 1956, cat. no . 192. Hermann Stenner 1891-1914, Spendhaus Reutlingen, May 5 - June 6, 1974, cat. no. 31. Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Malerei um 1900. Sonderleistungen der Klassischen Moderne. Die Hamburgische Sezession. Dder neue Realismus, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, March 31 - May 27, 1996 / Kloster Cismar, cat. no. 12 (fig. p. 47). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, December 1, 1999 - March 5, 2000 / Kunsthalle Wilhelmshaven, March 12 - April 24, 2000 / Kunst-Museum Ahlen, May 21 - July 16, 2000, Museum Baden, Solingen, August 20 - September 17, 2000. Zwischentöne-Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, November 16, 2000 - January 21, 2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle, January 28 - March 11, 2001. Malerei der Hamburgischen Sezession (1919-1933) aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin April 24 - June 17, 2001. Zwischentöne. Sonderentwickungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, June 29 - August 26, 2001 (fig. p. 27). Verlorene Nähe.Menschenbilder in der Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottdorf, Schleswig, December 1, 2001 - January 20, 2002, Städtische Galerie in der Reithalle Schloss Neuhaus, Paderborn, February 1 - March 13, 2002 / Kunsthaus Kaufbeuren, March 21 - June 9, 2002, cat. no. 111 (fig. p. 32). Hermann Stenner und der Hölzel-Kreis, Malerei und Graphik aus der Sammlung Bunte, Kunststiftung Hohenkarpfen, April 13 - August 17, 2003, cat. no. 17 (fig. 40, p. 49). Hermann Stenner, Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, June 1 - August 31, 2003 / Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, September 27 - November 16, 2003, El Greco und die Moderne. LITERATURE: Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, Munich 1975, catalogue raisonné no. G 157 and p. 55 (fig. 114). Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Catalogue raisonné of paintings, ed. by Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, catalogue raisonné no. 159 (fig. p. 217) Gustav Vriesen (ed.), Hermann Stenner 1891-1914, Bielefeld 1956, p. 160. Carsten Meyer-Tönnesmann, in: Heinz Spielmann (ed.), Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Malerei um 1900. Sonderleistungen der klassischen Moderne. Die Hamburgische Secession. Der neue Realismus, Hamburg/Cismar 1996, p. 46. Called up: December 9, 2023 - ca. 16.43 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Hermann Stenner 1891 Bielefeld - 1914 Ilow (Polen) Auferstehung. 1914. Öl auf Leinwand. 167 x 143 cm (65,7 x 56,2 in). Verso das Gemälde 'Badende Frauen' (Hülsewig-Johnen/Reipschläger 91). Das Gemälde entstand kurz vor Stenners Meerseburg-Aufenthalt noch in Stuttgart im Mai 1914. In einem Brief vom 1.5.1914 schreibt Stenner: '[..] ich war so in mein großes Bild vertieft, daß ich keine Zeit zum Schreiben fand. Ob es prämiert wird, ist zweifelhaft, denn erstens ist die Beteiligung (aller Länder am Rhein) so riesengroß, und zweitens mein Bild so modern, daß kaum Chancen vorhanden sein dürften [..] Eben waren Baumeister und Schlemmer bei mir. Beide waren mit meinem Bild einverstanden. Sie behaupten es sei das Beste, was ich bisher gemacht habe [..] Hölzel ist auch sehr befriedigt'. Und in einem Brief vom 12.5.1914 heißt es: 'Mein neues großes Bild kommt nun doch bestimmt in die Ausstellung. Hölzel hat mich heute dahin erklärt.' [JS]. • Das Werk „Auferstehung“ gilt als das Hauptwerk Hermann Stenners • Das Gemälde wird getragen von dem ungemein expressiven Kolorit und der dynamischen Kompositionsweise • Der Künstler Hermann Stenner markiert mit seiner Version des Themas der 'Auferstehung' einen Höhepunkt in seinem Werk, aber auch für den Expressionismus im Allgemeinen. PROVENIENZ: Aus dem Nachlass des Künstlers. Erich Stenner, Bielefeld. Sammlung Oetker 1956 - 1998 (Dauerleihgabe an die Kunsthalle Bielefeld). Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Kunstausstellung Stuttgart, Verband der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein, Königliches Kunstgebäude Stuttgart, Mai-Oktober 1914. Wilhelm Morgner – Hermann Stenner, Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, 2.-30.5.1954, Kat.-Nr. 44. Hermann Stenner 1891-1914, Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, 9.9.-14.10.1956, Kat.-Nr. 244 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett). Hermann Stenner 1891-1914, Spendhaus Reutlingen, 5.5.-16.6.1974, Kat.-Nr. 34 (m. Abb. 7). Der Hölzelkreis bis 1914, Kunsthalle Bielefeld, 30.6.-4.8.1974, Kat.-Nr. 154 (m. Abb. S. 83). Zwischen 'Brücke' und 'Blauer Reiter'. Rheinisch-Westfälischer Expressionismus, Kulturhistorisches Museum Waldhof, Bielefelder Kunstverein e. V., 9.12.1984-13.1.1985, Kat.-Nr. 21. Kunsthalle Bielefeld, Dauerleihgabe (ca. 1960 - nach 1985) The Fallen. An Exhibition of Nine Artists who lost their lives in World War One, Museum of Modern Art, Oxford, 5.11.1988-15.1.1989, S. 67. Hermann Stenner 1891-1914, Kunsthalle Bielefeld, 2.6.-25.8.1991; Städtische Galerie, Albstadt, 8.9.-27.10.1991; Galerie der Stadt Sindelfingen, 8.11.-29.12.1991, Kat.-Nr. 40 (m. Abb. S. 97). Expresionismo alemán, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 14.11.1995-25.2.1996, Abb. S. 192 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett). Die Sammlung Hermann-Josef Bunte. Deutsche Malerei des XX. Jahrhunderts, Hamburger Kunsthalle und Galerie der Haspa, 1.12.1999-5.3.2000; Kunsthalle Wilhelmshaven, 12.3.-24.4.2000; Kunst-Museum Ahlen, 21.5.-16.7.2000; Museum Baden, Solingen, 20.8.-17.9.2000. Zwischentöne. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Edwin-Scharff-Museum, Neu-Ulm, 16.11.2000-21.1.2001. Künstler der Hamburgischen Sezession aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Staatliche Galerie Moritzburg, Halle, 28.1.-11.3.2001. Malerei der Hamburgischen Sezession (1919-1933) aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte, Haus am Waldsee, Berlin, 24.4.-17.6.2001. Zwischentöne. Sonderentwicklungen des Expressionismus in der Sammlung Hermann Josef Bunte, Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 29.6.-26.8.2001, S. 28ff. (m. Abb. S. 29). Verlorene Nähe. Bilder vom Menschen in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Sammlung Bunte, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottdorf, Schleswig, 1.12.2001-20.1.2002; Städtische Galerie in der Reithalle, Schloss Neuhaus, Paderborn, 1.2.-13.3.2002; Kunsthaus Kaufbeuren, 22.3.-15.6.2002, Kat.-Nr. 117 (m. Abb. S. 31). Hermann Stenner. Gemälde. Retrospektive 1909-1914, Kunsthalle Bielefeld, 1.6.-31.8.2003; Galerie der Stadt Aschaffenburg, Jesuitenkirche, 27.9.-16.11.2003 Sammlung Bunte, Positionen der Klassischen Moderne, Kunst-Museum Ahlen, 25.02.-28.05.2007 (m. Ganzs. Farbabb. S. 265); Lyonel Feininger Galerie, Quedlinburg, 01.12.07-02.03.2008; Museum Moderne Kunst, Passau 09.08.-29.09.2008; Egon Schiele Art Centrum, Krumau 31.10.08.-01.02.2009; Ernst Barlach Stiftung Güstrow 27.09.09-17.01.2010; Kunsthaus Apolda Avantgarde 24.01.-05.04.2010; El Greco und die Moderne, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, 28.04.-12.08.2012 (m.Ganzs. Abb. S. 309) Hermann Stenner, Hymnen an das Leben, Werke aus der Sammlung Bunte,Städtisches Museum Engen + Galerie, 28.02.-02.07.2023, Kat. Nr. 81 (m.Ganzs. Abb. S.124) ; Kunsthaus Apolda Avantgarde, 09.07.-03.09.2023. LITERATUR: Jutta Hülsewig-Johnen/Christiane Reipschläger, Hermann Stenner. Werkverzeichnis der Gemälde, hrsg. vom Freundeskreis Hermann Stenner e. V., Bielefeld 2003, WVZ-Nr. 171 (m. Abb. S. 239). Hans Georg Gmelin, Hermann Stenner 1891-1941, München 1975, S. 59, WVZ-Nr. G 169 (m. Abb. 14). Hermann Stenner 1891-1914, Ausst.-Kat. Städtisches Kunsthaus, Bielefeld, hrsg. von Hans Hildebrandt, Bielefeld 1956, Abb. S. 27. Gustav Vriesen, Der Maler Hermann Stenner, in: Westfalen, Bd. 35, 1957, Heft 3, S. 166. Hans Georg Gmelin (Hrsg.), Der Hölzelkreis bis 1914, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Senne 1974, Abb. S. 83. Erich Stenner, Über das Werk meines Bruders Hermann Stenner (1910-1914), Halle/Westfalen 1981, S. 7 (m. Abb. S. 8). Ulrich Weisner (Hrsg.), Kunsthalle der Stadt Bielefeld, Katalog der Gemälde und Skulpturen des 20. Jahrhunderts, bearb. v. Donata von Puttkamer, Bielefeld 1985, Kat.-Nr. 313, S. 199f. (m. Abb.). Tim Cross (Hrsg.), The Fallen. An Exhibition of Nine Artists who lost their lives in World War One, Ausst.-Kat. Museum of Modern Art Oxford, Oxford 1988, S. 67 (Titelabb.). Hermann Stenner 1891-1914. Gemälde und Arbeiten auf Papier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld u. a., hrsg. von Hans-Michael Herzog, Bielefeld 1991, S. 22 u. S. 51. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.47 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.
Hans Spiegel 1894 Münnerstadt - 1966 Stuttgart Kubistische Komposition - Vertreibung. Um 1919. Öl auf Leinwand. Rechts unten monogrammiert. Verso auf der Leinwand zweifach erneut signiert. Verso auf dem Keilrahmen in Bleistift nummeriert '2079'. 68,5 x 87 cm (26,9 x 34,2 in). [KT]. • Seltenes Zeitdokument: Spiegels Frühwerk ist fast vollständig im Krieg zerstört worden. • Frühe Arbeit aus der Zeit der vom Kubismus geprägten 'Üecht-Gruppe' in Stuttgart zusammen mit Willi Baumeister, Oskar Schlemmer und Albert Mueller, als Ortsgruppe der Berliner Novembergruppe. • Spannungsvolle Arbeit im Wechselspiel fließender und geometrisch-geradliniger Formensprache. PROVENIENZ: Sammlung Rolf Deyhle, Stuttgart. Kunsthandel Widder, Wien. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Die Sammlung Rolf Deyhle. Figur und Abstraktion in der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig, 27.2.-13.6.1993; Galerie der Stadt Stuttgart, 1.12.1994-28.2.1995, S. 149, Kat.-Nr. 68 (m. Abb.). Hermann Stenner und seine Zeit, Kunstforum Hermann Stenner, Bielefeld, 20.1.-18.8.2019, S. 220, Kat.-Nr. 144. LITERATUR: Landesvertretung Baden-Württemberg Bonn und Stuttgarter Bank Stuttgart (Hrsg.), Stuttgarter Kunst von 1913 bis 1936, Bonn/Stuttgart 1988, S. 16f. Bassenge, Berlin, Auktion 6.6.2009, Moderne Kunst Teil I & II, Los 7321 (m. Abb.). Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.50 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONHans Spiegel 1894 Münnerstadt - 1966 Stuttgart Kubistische Komposition - Vertreibung. 1919. Oil on canvas. 68.5 x 87 cm (26.9 x 34.2 in). Called up: December 9, 2023 - ca. 16.50 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.
Josef Eberz 1880 Limburg an der Lahn - 1942 München Der Ersehnte. 1916. Öl auf Leinwand. Links unten signiert und datiert. 68,5 x 84,5 cm (26,9 x 33,2 in). [SM]. • Josef Eberz gehört ab 1907 zum Hölzel-Kreis. • Bereits kurz nach der Entstehung umfangreich ausgestellt, u. a. bei dem wichtigen Galeristen und Förderer junger Kunst Hans Goltz. • Das religiöse Sujet gehört zu Eberz’ Haupthemen. • Das vorliegende Werk ist eine typische Arbeit des jungen Künstlers, der von gotischen Glasfenstern die fest umrissenen Farbflächen und von den französischen 'Fauves' die stark leuchtende Farbigkeit übernimmt. PROVENIENZ: Sammlung Prof. Dr. Bernhard Heile, Wiesbaden. Privatsammlung Hermann Trick, Ziegelhausen (Heidelberg). Privatsammlung Baden-Württemberg. Sammlung Hermann-Josef Bunte, Hamburg/Bielefeld. AUSSTELLUNG: Sonderausstellung Josef Eberz, Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München 1917, Nr. 32. IX. Sonderausstellung Stanislaus Stückgold - Josef Eberz, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 1917. Josef Eberz - Edmund Fabry - Mely Joseph - Alice Lenhard-Falkenstein, Kunstsalon Ludwig Schames, Frankfurt a. Main, 1917. 44. Sonderausstellung Josef Eberz, Neue Kunst Hans Goltz, München, 1918. Josef Eberz, Kunstsalon Ludwig Schames, Frankfurt a. Main, 1918. Sonderausstellung Josef Eberz, Neues Museum Wiesbaden, 1919. Ausstellung aus Wiesbadener Privatbesitz, Wiesbaden, 1919, Kat.-Nr. 20. LITERATUR: Max Fischer, Josef Eberz und der neue Weg zur religiösen Malerei, München 1918. Leopold Zahn, Josef Eberz, Junge Kunst, Bd. 14, Leipzig 1920, S. 14 (m. Abb.). Leopold Zahn, Der Maler Josef Eberz, in: Der Cicerone, Jg. 12, 1920, S. 606. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 16.57 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONJosef Eberz 1880 Limburg an der Lahn - 1942 München Der Ersehnte. 1916. Oil on canvas. Lower left signed and dated. 68.5 x 84.5 cm (26.9 x 33.2 in). [SM]. • Josef Eberz became part of the Hölzel circle in 1907. • In many exhibitions shortly after it was made - at, among others, Galerie Hans Goltz, important gallerist and supporter of young art. • Religios subjects are among Eberz' main themes. • This is a typical work by the young artist, who found inspiration for the clearly defined color fields in Gothic windows and used the bright colors of the French Fauves. PROVENANCE: Collection Prof. Dr. Bernhard Heile, Wiesbaden. Private collection Hermann Trick, Ziegelhausen (Heidelberg). Private collection Baden-Württemberg. Hermann-Josef Bunte Collection, Bielefeld. EXHIBITION: Sonderausstellung Josef Eberz, Galerie Neue Kunst Hans Goltz, Munich 1917, no. 32. IX. Sonderausstellung Stanislaus Stückgold - Josef Eberz, Kestner-Gesellschaft, Hanover 1917. Josef Eberz - Edmund Fabry - Mely Joseph - Alice Lenhard-Falkenstein, Kunstsalon Ludwig Schames, Frankfurt a. M., 1917. 44. Sonderausstellung Josef Eberz, Neue Kunst Hans Goltz, Munich, 1918. Josef Eberz, Kunstsalon Ludwig Schames, Frankfurt a. M., 1918. Sonderausstellung Josef Eberz, Neues Museum Wiesbaden, 1919. Ausstellung aus Wiesbadener Privatbesitz, Wiesbaden, 1919, cat. no. 20. LITERATURE: Max Fischer, Josef Eberz und der neue Weg zur religiösen Malerei, Munich 1918. Leopold Zahn, Josef Eberz, Junge Kunst, vol. 14, Leipzig 1920, p. 14 with illu. Leopold Zahn, Der Maler Josef Eberz, in: 'Der Cicerone', vol. 12, 1920, p. 606. Called up: December 9, 2023 - ca. 16.57 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.
Paar achteckige Kakiemon-Schalen. Arita. Ca. 1670-1690Dekoriert in Emailfarben der typischen Kakiemon-Palette im Spiegel mit zwei ein Rund bildenden Phönixen, außen ein Phönix auf einem Päonienzweig und ein fliegender Phönix, am abgeschrägten Rand Blüte und Ranken, die Lippe braun glasiert.Kakiemon-Schalen wie diese, sowohl große wie kleine, und Kännchen sowie Becher wurden auf Konsolen in einem Wand füllenden, holzgeschnitzten Gitterwerk symmetrisch dekoriert, oft zu beiden Seiten eines Spiegels oder oberhalb eines Kamins. Die großen Residenzen in München, Dresden und Berlin hatte alle solche Kabinette und die kleineren Schlösser, Fürsten und Markgrafen machte es den Königen nach. Zu diesem bekannten Kakiemon-Modell der achteckigen Schale gibt es viele Dekorvarianten. Die Wandung außen kann geschmückt sein mit hōō, Bambus und Prunus (Rijksmuseum, Amsterdam, siehe Menno Fitski, Kakiemon Porcelain. A Handbook, Rijksmuseum 2011, S. 76, Abb. 76), mit Pferden auf einer Weide (Ashmolean Museum, Oxford, siehe Porcelain for Palaces, Oriental Ceramic Society, London 1990, S. 170, Kat.-Nr.150) oder mit Bambus, Felsen und Vogel (im Landesmuseum Kassel, siehe Porzellan aus China und Japan, Berlin 1990, S. 451, Kat.-Nr. 223). Das Motiv breitet sich jeweils über drei bis vier Felder, die sich durch die Form ergeben, aus. Innen befindet sich meist ein Medaillon aus zwei rund gelegten hōō-Vögeln.Das Motiv des hōō-Vogels, allgemein als Phönix bezeichnet, ist im Kakiemon-Porzellan häufig anzutreffen. Er ist ein Kompositwesen, das sich aus Merkmalen von Hahn, Fasan und Paradiesvogel zusammensetzt. In China Symbol der Kaiserin, wird er in Japan eher mit ehelicher Harmonie in Verbindung gebracht. Generell gilt der hōō als glückverheißend. Für den Europäer hingegen ist er der Inbegriff des Exotischen. Gerade die Kombination von Phönix und Prunus/Päonie wurde ein Leitmotiv der Meissen-Dekorationen „à la chinoise“.Das hier zum Ausruf kommende Schalenpaar war ehemals im Besitz der privaten Kunstsammlung von Großherzog Friedrich I. (1826-1907) von Baden, die er unter den Aspekten einer 1880 gegründeten Kunstkammer zusammengetragen hatten. Diese war seit 1879 in den Räumen des ehemaligen Großherzoglichen Naturalienkabinetts im Residenzschloss in Karlsruhe ausgestellt. 1883 erstellte der Kunsthistoriker Karl Koelitz (1852-1932) das „Beschreibendes Inventar (Katalog) der Allerhöchsten Privatsammlung kunstgewerblicher Gegenstände (Zähringer-Museum), aufgestellt in den Räumen des ehemaligen Großherzoglichen Naturalienkabinets“. Hier sind auf S. 121 unter der Rubrik „Französisches Fritten- oder Weich-Porzellan“ wie folgt erfasst: 1756.57. 2 achteckige Näpfe mit Blumenbüschen (Pfirsich) u. Paradiesvogel verziert“ (Abb. 1).Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs, der Abdankung Großherzog Friedrichs I. (1826-1907) von Baden am 22. November 1918 (von da an nannte er sich Markgraf von Baden) und infolge der Vermögenstrennung des Großherzoglichen Hauses und des Badischen Staates 1919 wurde die Kunstgegenstände in das Neue Schloss in Baden-Baden überführt, das nun Privateigentum der Markgrafen war. Zu diesen Beständen erstellte Galerieinspektor Richter das „Inventar des Zähringer Museums, aufgestellt in den Räumen des Kavalierbaus des Großherzoglichen Schlosses in Baden-Baden“.Das neue Zähringer Museum bestand in diesem Schloss bis 1981. Die Kunstsammlung und das Inventar wurden, um Schulden von 140 Millionen D-Mark des Hauses Baden zu begleichen und aus der finanziellen Schieflage zu kommen, 1995 von Sotheby's versteigert unter dem Schlagwort „Markgrafenauktion“. 2003 wurde das Schloss verkauft und wechselte häufiger die Besitzer, heute wird es von der Hotelgruppe Hyatt zum Luxushotel umgebaut.Abb. 1 Karl Koelitz, Beschreibendes Inventar (Katalog) der Allerhöchsten Privatsammlung kunstgewerblicher Gegenstände (Zähringer-Museum), Aufgestellt in den Räumen des ehemaligen Großherzoglichen Naturalienkabinets“, Karlsruhe 1883, S. 121, Rubrik „Französisches Porzellan“H je 10,1 cm; B 18,5 cmProvenienzEhemals Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden, verkauft bei Sotheby’s, Baden-Baden, 5.-21.10.1995, Lot 5295. Auf einer Schale zwei Papieretiketten am Boden mit alten Schlossinventarnummern 1756. und 2491Privatsammlung, Süddeutschland, erworben bei obiger Auktion
-
9954 Los(e)/Seite