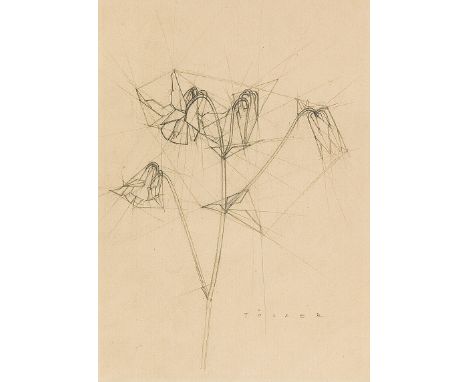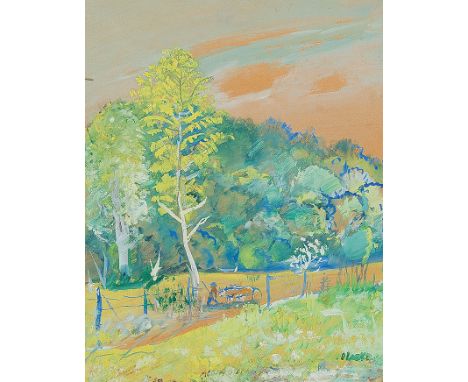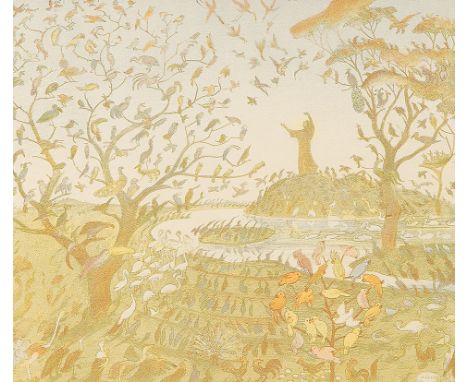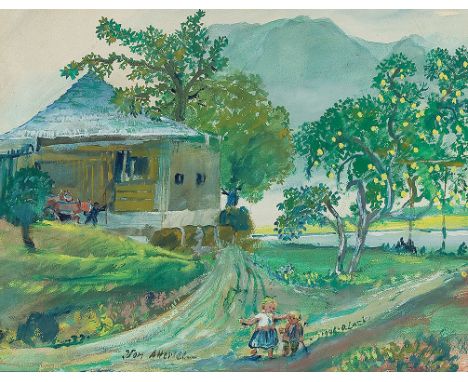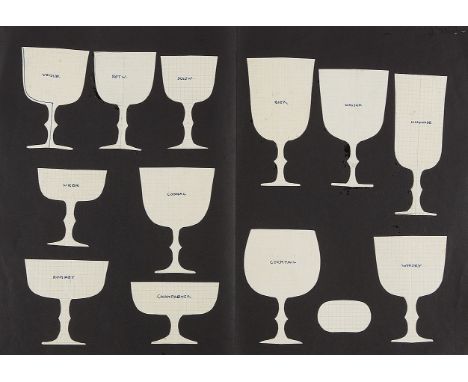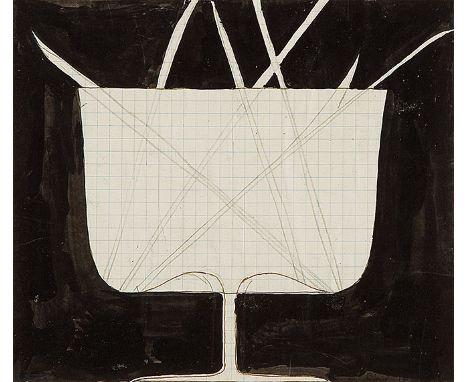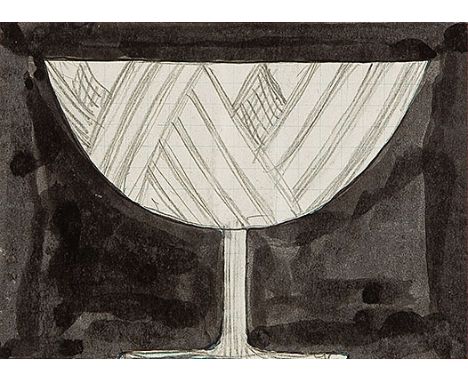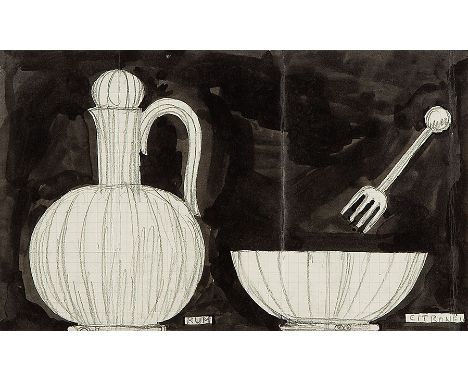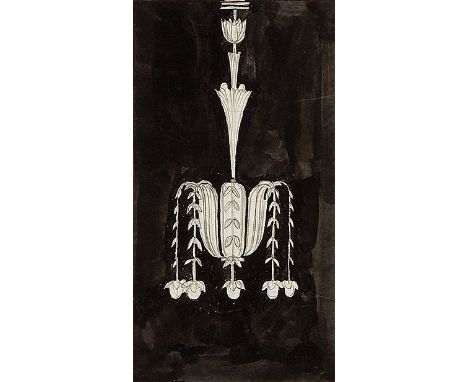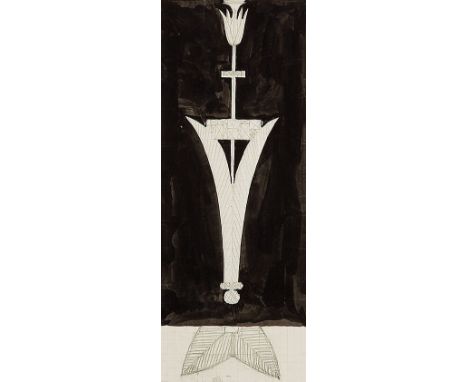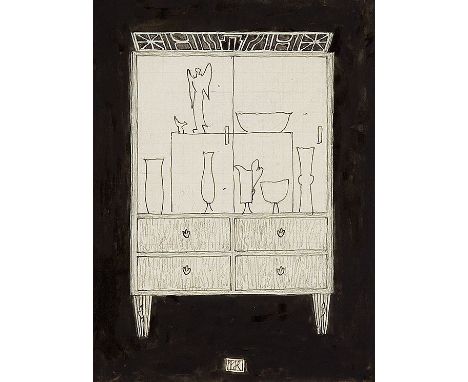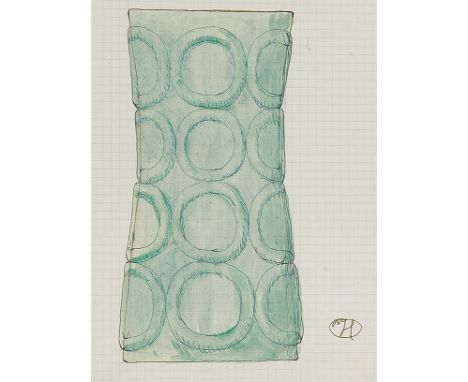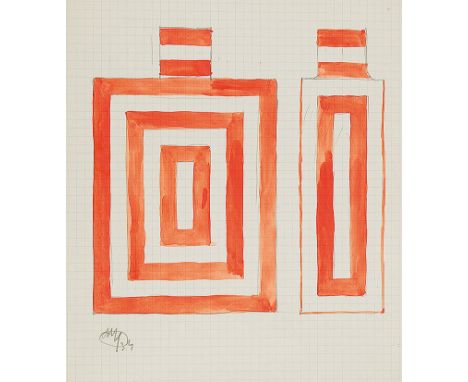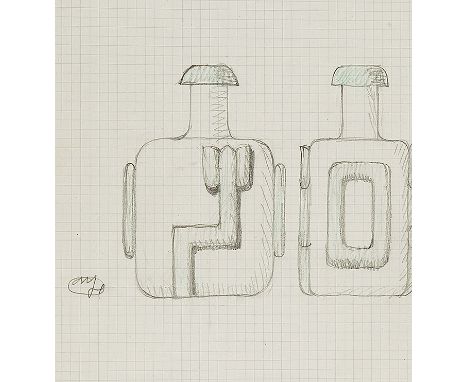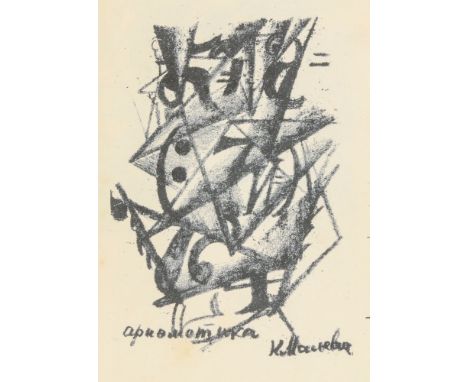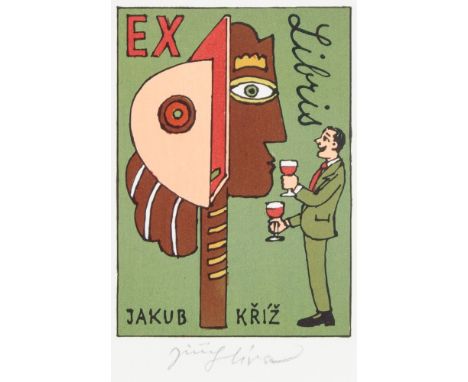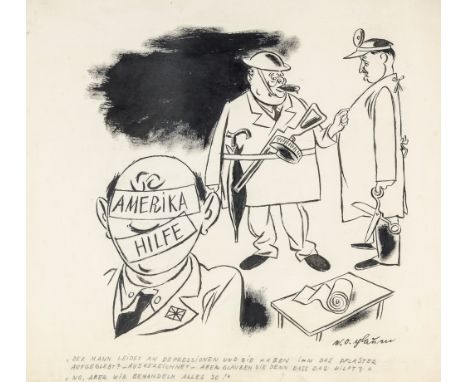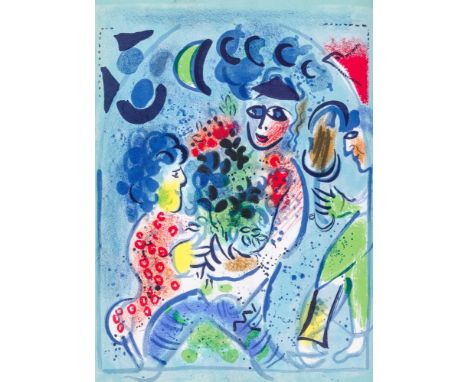We found 175434 price guide item(s) matching your search
There are 175434 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.
Click here to subscribe- List
- Grid
-
175434 item(s)/page
Stadtansicht "Haderslebia in Ducatu Slesuicensi uersus Fioniam, Opp, Arce Regia munitu, que forma quadrata aream exhibet, centu et quinquaginta paßus longam, ettotidem fere latam" (Haldersleben) 1585/1588, Vorlage wohl Melchior Lorck (1527-c.1595), colorierter Kupferstich, BM 19,5x57cm (m.PP. 45x62,5cm), Mittelfalz, o. beschn., kleine Defekte
Bedeutender Hamburger Barock-DeckelhumpenSilber; teilweise vergoldet. Auf einem aufgewölbten Fußwulst der zylindrische Korpus mit Scharnierdeckel. Das Mantelrelief umlaufend dekoriert mit einer qualitätvoll getriebenen Darstellung rastender Bauern in bukolischer Landschaft. Daumenrast und Henkel mit phantasievoll gestaltetem Knorpelwerk; im wenig aufgewölbten Scharnierdeckel ein Medaillon mit der plastisch getriebenen Darstellung eines Soldaten auf einem steigenden Pferd. Marken: BZ Hamburg für 1667 - vor 1688, MZ Jürgen Richels (1664 - 1711, Schliemann Nr. 41, 245). Niederländische Repunzierung von 1814 - 1893 mit Jahresbuchstabe L für 1845. H 22,5 cm, Gewicht 1.825 g.Hamburg, Jürgen Richels, um 1680.LiteraturVgl. einen Humpen Richels' in der Pfarrkirche von Lidingö in Schweden, abgebildet bei Schliemann 1985, Nr. 266. Zwei weitere Humpen des Meister befinden sich im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, abgebildet bei Hüseler, Hamburger Silber 1600 - 1800, Darmstadt o. J. , Nr. 25 f.
Seltener datierter Mörser von 1529Goldbrauner Bronzeguss mit Naturpatina. Zylindrisch, auf eckiger, ausgestellter Basis, der Rand leicht ausschwingend. Zwei facettierte eckige Henkel, darunter je ein Gießermonogramm und das Datum: "1529 Z O". H 17,6, D 16,9 cm. Gewicht ca. 7,8 kg.Norddeutschland, 1529.
ALBERT REUSS* (Wien 1889 - 1975 Mousehole, Cornwall) Die blauen Schuhe, 1948 Öl/Leinwand, 63 x 47,5 cm verso betitelt und datiert „the blue shoes“ 1948Provenienz: Kunsthandel Widder Wien, Europäische PrivatsammlungSCHÄTZPREIS: °€ 4.000 - 8.000 Österreichischer Maler und Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Vertreter der Exilkunst, gehört zur sog. verschollenen oder vergessenen Generation. Stammte aus einer jüdischen Familie und arbeitete zunächst als Schauspieler. Als Maler Autodidakt, stellte ab den 1920er Jahren in der Wiener Secession, im Hagenbund und in der Galerie Würthle aus. Ab 1932 Mitglied im Hagenbund. Ab Mitte der 1930er Jahre auch Bildhauer, 1935 Aufenthalt auf Gut Bedfordshire in England. 1938 Emigration über London nach Mousehole in Cornwall. Seine Frau führte die Galerie ARRA Gallery mit Künstlern wie Jack Pender oder Alexander Mackenzie der Künstlerkolonie St. Ives. Lebenslange Freundschaft mit dem Galeristen Jacques O´Hana. Frühe Einflüsse von Gustav Klimt und Egon Schiele, danach Einflüsse der expressiven Kärntner Malerei. Nach der Emigration Stilentwicklung in Richtung Neue Sachlichkeit und Surrealismus. Landschaften mit Figuren und einzelnen Objekten in zunehmend kühlen und zurückhaltenden Farben und monochromen Flächen. Farbigkeit, Rätselhaftigkeit und die statische, frontale Haltung des weiblichen Torso vergleichbar mit Arbeiten von Paul Delvaux. Komposition und Stimmung, Ruhe, Melancholie und Kontemplation vergleichbar ähnlich in den Werken Josef Floch. Albert Reuss, Sohn eines jüdischen Metzgers (namens Reiss) in Budapest, ging gegen den Willen des Vaters 18-jährig nach Wien, um Künstler zu werden. Er schulte sich an den Werken der großen Meister in den Wiener Museen, blieb aber Autodidakt. Sein Stil in diesen Jahren war expressiv, mit pastosem Farbauftrag und lebendiger Farbpalette. 1930 ermöglichte ihm ein Mäzen einen einjährigen Aufenthalt an der französischen Riviera. Die dort entstandenen Landschaften, Stillleben und Figurenbilder wurden 1931 in der Galerie Würthle in Wien ausgestellt, wo Reuss schon 1926, damals unter der Patronanz der Gesellschaft zur Förderung der modernen Kunst, eine Kollektivausstellung gezeigt hatte. 1932 wurde der Künstler Mitglied des Hagenbundes, emigrierte 1938 aufgrund wachsenden Drucks durch das Nazi Regime jedoch nach England. Dort stellte er wenig erfolgreich in Provinzgalerien aus und zog sich aufgrund der Gleichgültigkeit der Galeristen und des Publikums aufs Land nach Cornwall zurück, wo er sich aber weiter intensiv mit seiner Malerei beschäftigte. Seine Bilder wurden zusehends inhaltsschwerer und offenbarten seine psychische Befindlichkeit in dieser Zeit. Er selbst nannte die Früchte seiner Arbeit „Bilder der Einsamkeit“. 1975 wurden diese Werke in der Wiener BAWAG-Foundation gezeigt.
PETER TÖLZER* (Wien 1910 - 1997 Wien) Glockenblumen Bleistift/Papier, 31 x 22,5 cm signiert TölzerProvenienz: Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.500 - 3.000 Österreichischer Künstler des 20. Jahrhunderts. Vertreter der Wiener Avantgarde und des Kinetismus. Studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Franz Cizek und Bertold Löffler. Von 1935 bis 1953 Assistent und später Leiter der Klasse für Gebrauchs-, Illustrations- und Modegrafik. Frühe Arbeiten im Stil des Kinetismus wie auch Peter Tölzer, Erika Giovanna Klien, My Ullmann, Paul Kirnig, Elisabeth Karlinsky, Georg Anton Adams-Teltscher, Gertraud Brausewetter, Margarete Hamerschlag, Erika Giovanna Klien, Elisabeth Karlinsky, Paul Kirnig, Friedericke Nechansky, Gertrude Neuwirth, Ernst Anton Plischke, Johanna Reismayer, Ludwig Reutterer, Leopold Wolfgang Rochowanski, Emil Stejnar, Hertha Sladky, Harry Täuber, Gertrude Tomaschek, Otto Erich Wagner, Stella Weissenberg. Ab den 1920er Jahren Abkehr vom Kinetismus und Hinwendung zur gegenständlichen Malerei und der Neuen Sachlichkeit. Da der Kinetismus die erste Kunstrichtung der Moderne repräsentiert, deren wichtigste Vertreterinnen weiblich waren, bilden die männlichen eine Minderheit. Und da der Kinetismus weniger eine „Bewegung“, denn eine Lehrmethode darstellt, haben wir es bei vielen künstlerischen Belegen aus Franz Cižeks Formenlehre und seinen legendären Kinder- und Jugendkunstklassen mit Schülerzeichnungen zu tun, die zwar eine unglaubliche formale Präzision eint, deren Urheber und Urheberinnen meist völlig unbekannt, oft auch anonym geblieben sind. Paul Kirnigs kristalline Formen sind Ausdrucksmittel jener Licht- und Kristallmetaphorik, wie sie der Kinetismus als eine Sonderform des Kubismus verstand. Einen ersten Eindruck von der kubistischen Formensprache konnte man 1914 in der ersten umfassenden Picasso-Ausstellung in der Wiener Galerie Miethke gewinnen. Der zeitgenössische Schriftsteller und Kunstvermittler Leopold Wolfgang Rochowanski erkannte früh, dass der Kubismus der Cižek-Klasse „anders“ sei als jener Picassos und kommt zur Quintessenz: „Kubismus, sagt Professor Cižek, ist der kristallinische Ausdruck triebhaft drängender Gestaltungsenergien“. Kirnig analysiert hier nicht nur kristalline Formen, sondern bringt sie unter einem imaginären Druck zu Bruch und erzeugt damit jenes Chaos, das laut Rochowansky auch in Cižeks Arbeitsmethoden einkalkuliert war: „Der Unterricht (o altes Wort!) beginnt mit der Aufforderung, sich hemmungslos, mit der zügellosen Wildheit vorhandener Energien zu geben. Es entsteht: das Chaos. Aber schon die nächste Stunde ruft: Besinnung. Und die nächste Steigerung heißt: Ordnung.“
OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Altaussee Gouache/Papier, 38,4 x 30 cm signiert O. Laske und betitelt AltausseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 2.000 - 4.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.In die Reihe ländlicher Genrebilder aus Laskes Hand gehört auch das vorliegende Aquarell. Solche Ansichten Laskes entstammen den auch für diesen Künstler prekären Jahren während des Zweiten Weltkrieges, in denen sich Oskar Laske in eine Art „innere Emigration“ begab. Er hielt allerdings, soweit es ihm die Umstände ermöglichten, jenen geistig-intellektuellen Privatzirkel in seinem Haus aufrecht, der sich über die Jahrzehnte aufgebaut hatte. Ab dieser Zeit nahm auch seine umfangreiche Reisetätigkeit ab, und er konzentrierte sich fortan auf Ansichten aus Wien und Umgebung, in denen er jedoch seinen Kompositionseigenheiten treu blieb.
OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vogelpredigt des hl. Franziskus Farblithografie/Papier, 37 x 43 cm signiert im Stein O. LaskeProvenienz: Privatsammlung WienSCHÄTZPREIS: °€ 300 - 500 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.
OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vom Attersee, 1948 Gouache/Papier, 37,5 x 48,5 cm signiert O. Laske, datiert 1948 und betitelt Vom AtterseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 4.000 - 8.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.„Vom Attersee“ hat Laske das ländliche Idyll aus dem Jahr 1946 im Bild betitelt. Im Vordergrund unterhalten sich ein kleiner Bub, der einen Stecken hinter sich herzieht, und ein etwas größeres Mädel, das ihm mit großen Gesten begeistert etwas erklärt, auf einem Feldweg. Der Weg führt an einem schwer beladenen Birnbaum vorbei zum Ufer des namengebenden Sees. Im Mittelgrund ist ein Mann mit einer Peitsche in der Hand damit beschäftigt, ein zweispänniges Pferdefuhrwerk an einem Haus vorbei auf einen breiteren Feldweg zu bugsieren, während sich im Hintergrund, verbläut, majestätisch die Berge erheben.
OTTO RASIM (Wien 1878 - 1936 Innsbruck) Wintertag, 1935 Tempera/Karton, 39,5 x 38,3 cm signiert O. Rasim und datiert 1925 verso beschriftet Ein Wintertag Otto Rasim 1935, Frohe Weihnachten 1937Provenienz: Privatbesitz NiederösterreichSCHÄTZPREIS: € 2.000 - 4.000 Österreichischer Landschaftsmaler und Skifahrer. Besuchte die Künstlerkolonie in Dachau und war Schüler von Hans von Hayek. Ab 1904 in Mühlau bei Innsbruck, 1912 Gründung Künstlerbund Heimat (später Tiroler Künstlerbund). Einer der ersten "Schneemaler" in Tirol, Winterlandschaften und Gebirgsszenen wie Alfons Walde und Max von Esterle. Schneelandschaften vergleichbar mit Sebastian Isepp.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Blätter und Blüten Collage und Mischtechnik/Papier, 65,5 x 44,6 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Trinkgläser Collage/Papier, 42,1 x 59,5 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Stengelglas Bleistift und Tusche/Papier, 21,9 x 30,2 cm auf Karton montiertsigniert Hoffmann und monogrammiert JHverso beschriftet No 4, zweifach gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN.Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) verziertes Glas Bleistift und Tusche/Papier, 8 x 10,9 cm signiert Hoffmann, monogrammiert JH.verso beschriftet No. 35Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Glas mit floraler Verzierung Bleistift und Tusche/Papier, 9,9 x 10,2 cm monogrammiert JH und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Karaffe, Schüssel und Gabel Bleistift und Tusche/Papier, 16,6 x 26,4 cm auf Karton montiertmonogrammiert JH und beschriftet RUM CITRONEN verso gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF und HOFFMANN, nummeriert NR 22Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf eines Lusters Tusche und Bleistift/Papier, 19,3 x 32,6 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf einer Lampe Tusche und Bleistift/Papier, 30,4 x 32,8 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Vitrinenkasten Bleistift und Tusche/Papier, 21 x 15 cm monogrammiert JHverso beschriftet Vitrinenkasten und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN.Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Grüne Vase Tinte und Aquarell/Papier, 26,5 x 21 cm monogrammiert JHverso beschriftet 600 und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Roter Flakon Aquarell und Bleistift/Papier, 29,6 x 20,9 cm monogrammiert JH und datiert 34Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Flakon Bleistift und Buntstift/Papier, 28,9 x 20,8 cm monogrammiert JHProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.
Gonçalo Mabunda (Mozambique, né en 1975)O trono em dois tempos, 2015 fer, armes démilitarisées et matériaux de récupération soudésiron, demilitarized weapons and welded scrap materials103 x 80 x 52cm.40 9/16 x 31 1/2 x 20 1/2in.Footnotes:ProvenanceVente : Bonhams, New York, Modern & Contemporary African art, 2 mai 2019, lot 10Collection privée, FranceNé au Mozambique en 1975, Gonçalo Mabunda puise dans la mémoire collective de son pays, encore marquée par les violences de la guerre civile. Il transforme des armes démilitarisées en œuvres d'art engagées et percutantes, qui portent à la fois une forte connotation politique et une réflexion sur le pouvoir de la résilience et la créativité du Mozambique.Gervanne et Matthias Leridon découvrent les œuvres de Gonçalo Mabunda lors de la formidable exposition Bang ! Bang ! organisée en 2006 à Saint Etienne. Très vite, ils décident de le rencontrer et de soutenir cet artiste iconoclaste. Pour eux, Gonçalo Mabunda est un magicien de la vie, un sourire éclatant, une volonté de vivre pour mieux façonner un monde où chaque vie doit compter.En 2011, ils imaginent pour lui un projet fou : proposer à Bill Clinton que les Clinton Awards remis chaque année par au cours de la Clinton Global Initiative à New York soient réalisés par Gonçalo. Depuis cette date, on peut admirer sur le bureau de Bill Clinton un globe signé... Mabunda!Gonçalo Mabunda est un artiste majeur qui plonge ses mains dans l'ombre de l'histoire pour façonner l'humanité de demain.Born in Mozambique in 1975, Gonçalo Mabunda is a significant artist represented within the Gervanne + Matthias Leridon Collection. He transforms the disarmed weapons of the country's civil war into powerful works of art. Gervanne and Matthias Leridon first discovered the artist's works at the compelling 2006 exhibition Bang! Bang! Guns, Gangs, Games et Oeuvres d'Armes at the musée d'Art et d'Industries in Saint-Étienne, France. Their admiration for the artist's practice prompted the couple to extend their support. Their first meeting flourished into a mutual friendship. For the couple, Mabunda embodies the desire to shape a better world in which the impact of each life is felt. He is an artist who has plunged his hands into the shadows of history to shape the humanity of tomorrow.Motivated by their great admiration for the social impact of Mabunda's artistic practice, Gervanne and Mattias Leridon devised an ambitious plan: to ask the ex-president of the United States Bill Clinton if Gonçalo Mabunda could design the awards given at the annual Clinton Global Citizen Awards to honour individuals who have made an outstanding impact in philanthropy, government, civil society, and the corporate sector. Their proposal was accepted, and one of the awards stands proudly on Bill Clinton's desk.For further information on this lot please visit Bonhams.com
Höfische Brosche mit Burma-RubinenSilber auf 14 kt Gelbgold. Zweiteilig. Brosche in bombierter Ovalform und entsprechender volutenbekrönter Tropfenanhänger mit feinem radialem Durchbruch, im Verlauf ausgefasst mit kleinen Diamantrosen. Die Ränder umlaufend gesäumt mit kissenförmigen Altschliff-Diamanten in gekniffenen Zargenfassungen. Brosche mittig gefasst mit einem natürlichen pinkfarbenen Burma-Rubin im Kissen-Schliff ca. 3,66 ct (ca. 10,05 x 9.03 x 4,35 mm), carmosiert mit 22 Diamantrosen; der abnehmbare Anhänger in Entourageform gefasst mit einem natürlichen pinkfarbenen Burma-Rubin ca. 2,53 ct in ovalem Cabochon-Schliff (ca. 9,93 x 7,15 x 3,32 mm) und mit kleinen Diamantrosen. Diamanten zus. ca. 5,80 ct (M-O, vs-si; neun große Steine jeweils ca. 0,30 ct). Broschierung und Anhänger abnehmbar. Teil eines urspünglich größeren variablen Brustschmucks mit alten Schraubgewinden auf der Rückseite. Broschierung ersetzt. Höhe gesamt 8,5 cm. Brosche 4,0 x 4,5 cm. Anhänger 2,5 x 4,0 cm. Gesamtgewicht 28,70 g.Zweite Hälfte 19. Jh.
Belle Époque-Brosche mit DiamantenSilber, 14 kt Rotgold. Durchbrochene Lanzett-Form, gefasst mit 50 Diamanten im kissenförmigen Alt-Schliff (zus. ca. 1,40 ct, M-O, si-p). Undeutlich gestempelt: Wiener Feingehalt 585 mit Kontrollamtsstempel, ab 1872 (Neuwirth, T 7, 15), MZ "FG", wohl Firma Ferdinand Godina, Gewerbeverleihung 1857. Minimale Altreparatur. L 6,7 cm. Gewicht 8,16 g.Wien, um 1880/90.
EMERALD AND PEARL RING,set with a row of emeralds and pearls, to an openwork shank with engraved decoration, in twelve carat gold, size O, 1.9gGenerally worn condition. Some wear to the engraved shank. Inclusions visible within the emeralds. Some nicks and abrasions to the emeralds. All stones intact.
RUBIN-DIAMANT-ARMAND. Herkunft: Wohl Deutschland. Material: 585/- Weiß-, Roségold, Punze. Gesamtgewicht: ca. 130,5 g. Maße: Länge 19,2 cm, Breite 3,3 cm. Diamanten: Ca. 636 Diamanten im Übergangs-Schliff zus. ca. 26,2 ct. L-O/VS-P, einige Steine leicht cognacfarben, mittig 1 Brillant ca. 0,7 ct. N/SI1. Edelsteine: Ca. 65 runde bis ovale, facettierte Rubine zus. ca. 24,2 ct. Schmuck Armband Roségold Rubin 20ct + DeutschlandErläuterungen zum Katalog
DIAMANT-CREOLEN. Herkunft: Deutschland. Material: 750/- Gelbgold, getestet. Gesamtgewicht: ca. 21,0 g. Maße: Ø 2,1 cm. Diamanten: 2 Brillanten zus. ca. 0,8 ct. M/SI1, 10 dreieckige, facettierte Diamanten zus. ca. 1,3 ct. M-O/SI1. Schmuck Ohrschmuck Gelbgold Diamant DeutschlandErläuterungen zum Katalog
Expressionismus - - Das Kunstblatt. Herausgegeben von Paul Westheim. Jahrgang I (1917), Hefte 1-12 (komplett). Mit 11 Original-Graphiken und zahlreichen, teils farbigen Abbildungen im Text und auf Tafeln. Potsdam, Kiepenheuer, 1917. 1 Bl., 383 S., 5 Bl. 29 x 22 cm. Original-Broschuren (Klammerung gerostet, 1 Vorderdeckel mit Notiz "Kokoschka" in Kugelschreiber, vereinzelt mit kleiner Randläsur, gebräunt und etwas stockfleckig).Söhn III, 31602-31612 - Schlawe II, 35. - Der erste Jahrgang des bedeutendsten Organs des künstlerischen Expressionismus mit Original-Holzschnitten von G. Schrimpf, W. Klemm, H. Campendonk (Mädchen mit Fröschen, Engels 25) und O. Lange (Porträt, Rifkind 1923) sowie Original-Lithographien von W. Schmid (Sängerin, Rifkind 2512), J. Eberz (Flusslandschaft, Rifkind 498), L. Meidner (Porträt, Rifkind 1923), Milly Steger (Auferstehen, Rifkind 2830), St. Stückgold (Erfüllung, Rifkind 2884), O. Kokoschka (Porträt Käthe Richter, Wingler-W. 112) und J. Bolschweiler (Gärtnerei, Rifkind 306). - Eine Graphik gelockert, vereinzelt etwas fleckig, sonst gutes Exemplar.
Expressionismus - - Die neue Malerei. Expressionistische Ausstellung Januar 1914. Mit 11 (statt 12) Abbildungen auf Tafeln. Dresden, Galerie Ernst Arnold, 1914. 18 S., 1 Bl.22,5 x 16 cm. Original-Broschur mit Klammerheftung (es fehlt der Hinterdeckel, Vorderdeckel mit Einriss im oberen Falzbereich).Seltener Katalog zu der expresionistischen Ausstellung bei Arnold. Mit Abbildungen von Werken von Egon Adler, Adolf Erbslöh, Lyonel Feininger, Erich Heckel, A.von Jawlensky, W. Kandinsky, A. Kanoldt, O. Kokoschka, Franz Marc u.a. - Papierbedingt leicht gebräunt.
Heckel, Erich. Ausstellung Kunsthütte Chemnitz. Mit 16 Tafeln und Original-Umschlag mit Original-Farbholzschnitt in Braun und Schwarz von Erich Heckel. Chemnitz, 1930. 15 S. 21,5 x 16,5 cm. Original-Umschlag (Rücken etwas berieben, leicht gebräunt).Dube 346. - Der leporelloartige Umschlag zeigt neben einer Ansicht der Stadt Chemnitz mit Heckel als Hochseilartist auch ein Gruppenbild aller vier Meister der "Brücke": Heckel, Kirchner, O. Mueller und Schmidt-Rottluff. - Block gelockert lose, Titel und letzte weiße Seite etwas fleckig, sonst gutes Exemplar.
Asien - China - - Matusovskij, Zinovij L. und Sergej N. Nikitin. Karta Kitajskoj imperii, sostavlennaya po sovremennym svedeniyam. (Karte des Chinesischen Imperiums, erstellt nach aktuellen Informationen). Farbig lithographiert. Ekaterinburg (und Sankt-Petersburg), verlegt bei der Litho-Druckerei I. O. Ivanov (für die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften), 1887/88 (?). 4 x 6 Segmente auf Leinen aufgezogen. Gesamtmaß: 106 x 128 cm.Wohl seltene erste Ausgabe. - Im Rahmen der großen Karte (Maßstab ca. 1:4.613.000) sind am linken und unteren Rand sieben kleinere Pläne enthalten (darunter von Städten wie Peking, Kanton und Schanghai) jeweils mit separaten Maßstäben. Topographische Besonderheiten und politische Grenzen sowie Verkehrsverbindungen sind farblich akzentuiert. Weltweit nur ein Exemplar in öffentlichen Bibliotheken außerhalb Russlands verzeichnet (Maße und Maßstab dort abweichend: 107 x 88 cm und 1: 5.300.000). - Die letzte Ziffer der auf der Karte angegebenen Jahreszahl wurde auf dem vorliegenden Exemplar überklebt (mit einer 8). Verso auf dem Leinen in einer Ecke mit Besitzstempel und zwei kurzen, gelöschten Vermerken in Filzstift. - Weißer Rand etwas (finger-) fleckig.
Bauhaus - - Schmidt, Joost. Der Bauhaustapete gehört die Zukunft. 1931. 2 Bl. 14,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter Original-Umschlag (leicht berieben, Hinterdeckel im linken Rand hinterlegt und im Falz geklebt).Brüning, Das A und O des Bauhauses, Nr. 166. - Hervorragend gestaltete Werbebroschüre für die Bauhaustapete. - Die Seiten waren wohl lose und wurden innen im Falz geklebt, leicht gebräunt.
Sammlung Schaffernicht - - Mühl, Otto. Sammlung von 12 Publikationen und 6 Flugblättern zu Mühls Werk. Verschiedene Orte und Verlage. Ca. 1966-1985.Die Sammlung enthält u.a.: I. Mama & Papa. Materialaktion 63-69. Frankfurt, Kohlkunst, um 1970. - Dazu eine Doublette. - II. O Tannebaum. Dokumentation über Otto Mühls Materialaktion in der SHFBK Braunschweig und deren Folgen. Herausgegeben von Dozenten und Studenten der SHFBK. Braunschweig, ASTA, um 1969. - III. Ausgewählte Arbeiten. 1963-1986. Wien, Hubert Klocker, um 1985. - IV. Postaktionistische Malerei. Kiel, Galerie Isides, 1978. - V. Drei Flugblätter zu Publikationen zu Mühl. Mit Abbildungen. - VI. Schäffelein, Konrad Balder. La vie pour la vie. Einfälle bei der Betrachtung von Fotografien Mühlscher Szenen. 4 S. - VII. Diskus. Frankfurter Studentenzeitung. 16. Jg. Heft 4. 1966. - Mit einem ganzseitigen Text von Peter Weibel "7 Sektionen zu Otto Mühls Materialaktionen" mit mehreren Abbildungen. - VIII. Zwei Flugblätter zu Aufführungen von Filmen über Brus Aktionen: O Tannebaum zu einer Aufführung in Hamburg 1971. - Sodoma und verso zu Marc Adrians Theorea zur Aufführung in Hamburg 1971. - Insgesamt gut erhalten. - Provenienz: Archiv Ed Sommer.
Avantgarde - Russland - - Kruchenyh, Aleksej E. Vo-zrop-shchem. (Vozropshchem). (Wir murren auf). Mit 2 Original-Lithographien von K. Malevich und 1 Original-Lithographie von O. Rozanova und 1 Tafel. Sankt-Petersburg, (EUY), 1913. 12 Bl. 18,5 x 14 cm. Typographische Original-Broschur (fleckig, Rücken mit alten Montierungsspuren, am Gelenk oben ca. 6 cm und unten ca. 3 cm eingerissen, hinterlegter Einriss rechts unten, hinten mit kleinem schwachen Händlerstempel). Erste Ausgabe. - MoMA, 75 - Hellyer, 255 - Polyakov 31 - Lesman 1162. - Das erste lithographierte Buch des Autors. Selten, bedeutendes Werk des russischen Futurismus. Vom Autor der "ersten Künstlerin Petrograds O. Rozanova" gewidmete Publikation. Den Druck besorgte die Druck-Genossenschaft "Svet". Die Lithographien auf dünnem Papier in kleinerem Format (17,5 x 11,5 cm). Erschienen ohne Titelblatt. - S. 1 mit kleineren Stempelfragmenten. - Die vorgebundenen Tafeln fast aus der Bindung gelöst, das erste Blatt unten mit kleinen Fehlstellen, ein Blatt knickspurig, leicht gebräunt.
Sammlung Schaffernicht - - Mühl, Otto und Marc Adrian. Sehr umfangreiche Bilddokumentation zu Mühls Materialaktion 17 O(h) Tanne(n)baum. Mit 152 Original-Photographien. Vintages. Silbergelatine auf Agfa. 1964. Ca. 17,5 x 12,5 cm (die Formate variieren um wenige Millimeter). In 2 Leinenkassetten mit montierten Deckel- und Rückenschildern (etwas fleckig und berieben).Sehr umfangreiche Dokumentation zu Mühls skandalöser Materialaktion am 19.12.1964 im Perinetkeller. - Vgl. Wiener Aktionismus 1960-71 II S. 245 - Husslein-Arco F1964 3 (5 Photos abgebildet). - Noever, Otto Mühl S. 97 (hier als Materialaktion 15 bezeichnet). - Die Aktion wurde auch von Kurt Kren gefilmt der Schwierigkeiten hatte, hierfür eine Kopieranstalt zu finden. - Die Photographien befinden sich in 12 Klarsichthüllen mit handschriftlich bezeichneten Blättern: Introitus und Waschung (5), Investitur Salbung und Sanctus (29), Stufengebet (8), Levatio (12), Predigt und Sanctus (15), Wandlung (7), 1. Sacrificium (24), 2. Sacrificium (12), Donation (13), Devotion (3), Pater Noster (8) und Ite, missa est (7). - Verso handschriftlich nummeriert. - Leicht gewellt, Kanten teils leicht bestoßen, teils leicht kratzspurig. - Die Folge war ein Geschenk Adrians an Sommer. - Beiliegend: Kurzes signiertes Schreiben von Ed Sommer an Christian Schaffernicht vom 23.9.1998, in dem Sommer Adrian als Urheber der vorliegenden Photos nennt. - Insgesamt gut erhalten. - Provenienz: Sammlung Ed Sommer.
Avantgarde - Russland - - Troshin, Nikolaj S. Osnovy kompozicii v fotografii. (Grundlagen der Komposition in der Photographie). Konstruktivistische Umschlaggestaltung und Layout von Ol'ga Dejneko. Mit 58 photographischen Illustrationen. Moskau, Sovetskoe foto, 1929. 118 S., 1 Bl. 25 x 18 cm. Zweifarbig illustrierte Original-Broschur (fleckig, Kapitale mit Fehlstellen, knickspurig, restaurierter Einriss rechts oben).Erste Ausgabe. - Erschienen in der Verlagsreihe: Biblioteka zhurnala "Sovetskoe foto". Der Autor, u.a. beteiligt an sowjetischen Prachtausgaben und der Zeitschrift "USSR im Bau", legte mit dieser Ausgabe einen eindrücklich illustrierten theoretischen Text vor. Viele Projekte realisierte er gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin O. Dejnkeko. Die Illustrationen hier nach Aufnahmen von B. Ignatovich, A. Shajhet, N. Stercer, S. Fridlyand, B. Ulitin u.a. - Die Seiten 1-30 im oberen Rand rechts mit restauriertem Einriss (von ca. 2 x 1 cm zur Heftmitte abnehmend), sonst innen gut erhalten.
Exlibris - - Sammlung von ca. 360 (teils signierten) tschechischen Exlibris. Verschiedene Techniken und Formate. 20. Jahrhundert. Unter Passepartouts. Enthält Exlibris von: A. Moravek (20), J. Votruba (12), K. Müller (15), V. Vavra (10), O. Marik (13), K. Kunes (10), J. Pavlik (5), P. Rolcik (14), J. Podhajsky (12), K. Minar (8), K. Stech (21), J. Buda, V. Burda, J. Cernos, E. Haskova, J. Newirt u.a. - Meist mit Schild mit Künstlernamen.
Mappenwerk - - Kölner Kunstmarkt 70. Mappe mit 26 (von 27) Graphiken. Alle Blätter signiert bzw. monogrammiert, teils datiert, nummeriert und betitelt. Aus einer Auflage von 250 Exemplaren. Unterschiedliche Techniken auf unterschiedlichen Papieren. Blattgrößen bis ca. 45 x 32 cm. Lose in Original-Kartonkassette.Mit einem Doppelbogen, Künstlerliste und Impressum sowie mit dem gebundenen Ausstellungskatalog, erschienen im Verein progressiver deutscher Kunsthändler e.V., Köln 1970. - Mit Arbeiten von: K.F. Bohrmann, V. Bonato, C. Böhmler, A. Cote, G. Gasioroski, B. Gironcoli, J. Grützke, E. Hauser, J. Hennemann, H.E. Kalinowski, W. Knaupp, F. Koenig, F. Kriwet, N. Krushenick, G. Kuehn, Sol Le Witt, H. Mack, Palermo, A.R. Penck, O. Piene, S. Polke, Birgit Polk/Gerhard Richter, R. Schwarz, L. Stafford, Cy Twombly und H.P. Zimmer. - Lose Bögen in Original-Papierumschlägen, dort typographisch mit dem jeweiligen Künstlernamen. - Die Arbeit von H.P. Zimmer ist im Impressum fälschlich mit "Zimmermann, Hans Peter" benannt. - Es fehlt die Arbeit von Ken Danby. - Kassette etwas fleckig und kratzspurig, die Graphiken sehr gut erhalten.
Ohser, Erich (Pseudonym: e. o. plauen). Amerika Hilfe. Federzeichnung auf festem Velin. Signiert unten rechts. Um 1942. Blattmaße: 30,5 x 33 cm.Der berühmte Schöpfer von "Vater und Sohn" und enge Freund und Illustrator Erich Kästners, Erich Ohser (1903-1944), konnte sich nach 1933 leidlich mit dem Nazi-Regime arrangieren. Obwohl ein früher Gegner der Nationalsozialisten, lieferte er ab 1940 politische Karikaturen für die NS-Zeitschrift "Das Reich". Die vorliegende Zeichnung, die einen absurden Dialog zwischen Churchill und einem englischen Arzt illustriert, spiegelt seine Selbstrechtfertigung "Ich zeichne gegen die Alliierten - und nicht für die Nationalsozialisten". 1944 sollten ihm und seinen Freund Erich Knauf ein paar regimefeindliche Witze dennoch zum Verhängnis werden. Denunziert und inhaftiert, erhängte sich Ohser im Gefängnis, während "der dritte Erich" hingerichtet wurde. - Dabei: Zwei eigenhändige Briefe des Künstlers an Robert Marx auf dem mit "Vater und Sohn" bedruckten Briefpapier des Graphikers. Beide signiert mit "e.o. plauen", einer datiert "6. August 1942". - "Ihre gute Meinung über meine Zeichungen hat mich so gefreut, dass ich Ihnen ein Original an die angegebene Adresse geschickt habe." - Die Zeichnung verso auf Karton montiert, leicht gewellt und minimal angestaubt; die Briefe mehrfach gefaltet und etwas knittrig. - Provenienz: Sammlung Marx, Berlin.
Inkunabeln - - Petrus de Bergamo. Tabula o(mn)i(u)m operu(m)Divini doctoris sancti Thome Aquin(atis). Basel, Nikolaus Kessler, 1495. 296 nn. Bl. (letztes weiß). Initialspatien nicht ausgefüllt. 22,5 x 15,5 cm. Lederband der Zeit mit Streicheisenlinien und 1 Messingschließe (Riegel fehlt, berieben, bestoßen und etwas wurmstichig, unteres Kapital ausgefranst, Bezug der Innendeckel über Handschriftenmakulatur verloren).GW M32085; BSB-Ink P-346 (nur 288 Bl.). - Etwa vierter Druck, zuerst in Bologna 1473 erschienen. Exemplar mit dem häufig fehlenden und offenbar nachgetragenen Zusatzbogen von acht Blatt zwischen den Schlusslagen H8 und I10. - Alter Parochial-Besitzvermerk, erstes und letztes Blatt stärker wurmstichig (Buchstabenverlust) sowie randfleckig, streckenweise weitere feine Wurmspuren, insgesamt bis auf gelegentliche Wasserflecken im Kopfrand sauberes Exemplar.
Brinkmann, Rolf Dieter. Der Gummibaum. Hauszeitschrift für neue Dichtung, herausgegeben von R. D. Brinkmann u.a. Nr. 1-3 und 1.-2. Sonderausgabe in 5 Heften. Mit zahlreichen Illustrationen von EXIT (Berndt Höppner u.a.). Köln bzw. Frankfurt, 1969-1970. 29,7 x 21 cm. Hektographierte Bl. mit Klammerheftung. Vollständige Folge aus der "Blütezeit" (Seinsoth) des alternativen Magazins für Undergroundliteratur und Lyrik, das dann noch bis 1973 in Frankfurt weitergeführt wurde. - Seinsoth 29-32 (ohne die Sonderausgabe 1). - In der Annotation zur 2. Sonderausgabe schreibt Seinsoth: "Die 1. Sonderausgabe des 'Gummibaum' ist nie erschienen (Auskunft Ralf-Rainer Rygulla)." - Die Nummern 1-2 erschienen 1969 in Köln mit jeweils 400 Exemplaren; Nr. 3 erschien 1970 in Frankfurt mit 500 Exemplaren. Die 1. Sonderausgabe, herausgegeben von Henning John von Freyend, erschien 1970 in Köln in 300 Exemplaren; die 2., kaum auffindbare Sonderausgabe, wurde von Renate und Peter O. Chotjewitz 1970 mit dem Copyright "Roma" in 300 Exemplaren herausgegeben. - Die angegebenen Auflagen wurden wohl nie erreicht, da die verwendeten Matrizen vorher abgenutzt waren und die Nachfrage zu gering war. - Sehr gut erhaltene Reihe.
Chagall, Marc - - Cain, Julien. Chagall Lithograph III. 1962-68. Deutsch von O. Baumgartner. Mit zahlreichen, größtenteils farbigen Abbildungen und 2 Original-Lithographien (Umschlag und Frontispiz). Monte Carlo, Sauret, 1969. 179 S. 32,5 x 25 cm. Original-Leinwand mit farbig lithographiertem Original-Schutzumschlag mit Original-Klarsichtumschlag. Band 3 des maßgeblichen Werkverzeichnisses der Lithographien in deutscher Sprache. - Sehr gutes Exemplar. - Dabei: Sorlier, Charles. Die Keramiken und Skulpturen von Chagall. Vorwort von André Malraux. Mit 1 farbigen Original-Lithographie und zahlreichen meist farbigen Abbildungen. Monco, Sauret, 1972. 249 S., 1 Bl. 33 x 25 cm. Original-Leinwand im Original-Schutzumschlag. - Sehr gutes Exemplar.
-
175434 item(s)/page